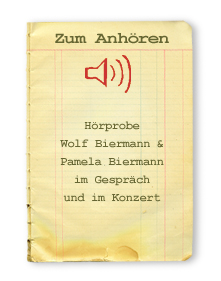Esssays
Wolf Biermann zum Marion Samuel Preis in Augsburg
Wolf Biermann zum Marion Samuel Preis in Augsburg
Wolf Biermann über Bertholt Brecht
Ekel und Genie • Essay •
Werner Hechts Biografie über Bertolt
Brecht zeigt einen wankelmütigen Helden
Wolf Biermans Ermutigung an Vitali Klitschko
Wolf Biermans Ermutigung an Vitali Klitschko
Text und Unterzeichner
Du bist schuld an allem! Und wir danken es Dir.
Rede zur Verleihung des Bertini-Preises
im Ernst-Deutsch-Theater. Montag, 26. Jan. 2014
Mein Freund lügt nicht
Wolf BIermann: Offener Brief an Liao Yiwu
Veröffentlicht am 28.März 2013 im Feuilleton der WELT
Glanz und Elend der Demokratie
Vortrag am 15. September 2011, Wien, im Parlament
Rede bei der Vorstellung des Buches „Der aufrechte Gang„
am 26. März 2009 im Schloss Bellevue
Wolfgang Heise - mein DDR-Voltaire
Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde
Humboldt-Universität zu Berlin am 7. November 2008
Das Schweigen der Quandts
Lobrede am 16.10.08 im WDR Köln für einen Film von Eric Friedler
Jüdischer Selbsthaß und Haß auf Juden
Tacheles zum Theodor-Lessing-Preis am 6. März 2008 in Hannover
Comeback eines toten Hundes
Wolf Biermann über die Wiederbelebung des Begriffs "Demokratischer Sozialismus" durch Kurt Beck
Rede im Roten Rathaus
am 26. März 2007 zur Verleihung der 115. Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin
Wir verkennen die Tragik des Nahostkonflikts und sympathisieren in vormundschaftlicher Verachtung mit radikalen Moslems.
Eine Gastvorlesung von Wolf Biermann in Jerusalem und Haifa im Oktober 2006
Hoffmann von Fallersleben.
Rede am 1. Mai 2006 in Höxter
Wolf Biermann zum Marion Samuel Preis in Augsburg
Wolf Biermann zum Marion Samuel Preis in Augsburg
Wolf Biermann
Rede, zwei Lieder und ein Gedicht in Augsburg
7. Dezember 2015, im Goldenen Saal des Rathauses der Stadt
Als die Stiftung für den Marion Samuel-Preis bei mir anfragte, ob ich diese Ehrung annehme und dafür nach Augsburg komme, hörte ich zum ersten Mal von dem jüdischen Mädchen Marion, das 1931 in Deutschland geboren und mit 12 Jahren nach Auschwitz deportiert wurde. Dann las ich die berührende Monographie des Historikers Götz Ali über ihr Schicksal.
Als ich das Datum ihres Todes sah, wußte ich: Diese Marion Samuel aus Brandenburg ist zufällig in den selben Tagen ermordet worden in Auschwitz wie mein Vater Dagobert Biermann. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, daß dessen alter Sohn Wolf es verdient hat, solch eine Auszeichnung entgegenzunehmen.
Die Toten bleiben jung - schrieb Anna Seghers - und das stimmt. Als ich 1976 mein Kölner Konzert machte, überholte ich meinen Vater: wurde zum ersten Mal älter als er. Immerhin! dachte ich, und fühlte mich wie ein kommunistischer Gottesbeweis dafür, daß es trotzalledem voran geht mit der Menschheit.
So blieb mein Vater für mich ewig ein junger Mann von 39 Jahren. Und ich bin nun ein Greis, der nächstes Jahr wohl 80 wird. Und das ist - nebenbei gesagt - tröstlich und ein Beweis für gar nichts.
Sie alle kennen das größte dezentrale Mahnmal der Welt für die Opfer des Holocaust: die so genannten Stolpersteine. Wenn ich irgendwo in Deutschland über einen der gut 50 Tausend bisher verlegten Beton-Würfel mit der gestanzten Messingplatte stolpere, freue ich mich doppelt: Erstens weil ich diese eine effektive Idee eines Bildenden Künstlers sympathisch finde. Noch mehr aber freut mich, daß ich für meinen Vater keinen Stolperstein bei dem Projekt-Künstler Gunter Demnig bestellen und von ihm verlegen lassen muß. Über meines Vaters Namen wird also in Hamburg kein Straßenpassant latschen und kein Hund pissen.
Mein Vater genießt ein Privileg: Er braucht keinen solchen Stolperstein, der die Nachgeborenen an ihn erinnert. Der Kommunist Dagobert „Israel“ Biermann hat einen Sohn, der genug Stolpersteine aus Worten und Tönen gepflastert hat. Es sind meine Lieder und Gedichte, die an das Schicksal unserer Familie erinnern: an meine fünfzehn Hamburger Verwandten, die jüdischen Großeltern John Biermann und seine Frau Luise Löwenthal.
Ich singe Ihnen gleich noch zwei Lieder vor und lese ein Gedicht, geschrieben für meines Vaters hübsche sephardische Schwester Rosi Biermann und für ihren Sohn Peter, der im gleichen Jahr wie ich geboren wurde. Sie wohnten in der Straße Pilatuspool bei „Planten un Blomen“. Meine Texte erinnern auch an die Onkel und Tanten, meine Cousins und Cousinen, sie alle wurden von den Nazis im traurigen Monat November von Hamburg 1941 nach Minsk deportiert und gleich am nächsten Morgen in die Grube geschossen.
Anfang der 90er Jahre bat mich mein älterer Herzensbruder und Historiker Arno Lustiger, das jiddische Poem von Jizchak Katzenelson ins Deutsche zu dichten: „Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk“. Arno Lustiger brauchte eigentlich nur das Finale dieser herzzerreißenden Verse, das Kapitel über das Warschauer Ghetto und den Aufstand 1943. Er nutzte die Verse als starkes Beweisdokument für sein neues Buch über den Widerstand der Juden gegen Hitlers Endlösung in ganz Europa.
Und ich füge für den Stifter des Marion-Salomo-Preises, für Sie lieber Walther Seinsch besonders interessant, eine Anmerkung ein: Arno Lustiger schrieb all seine Bücher über den bewaffneten Kampf der Juden in der Shoa auch im tiefen Meinungsstreit mit dem Historiker Professor Dr. Raul Hilberg, der hier in Augsburg mit dem Marion-Samuel-Preis 1999 als Allererster geehrt wurde.
Arno Lustiger, der polnische Jude aus Będzin, wollte nicht die gängige Lehrmeinung akzeptieren, die Juden hätten sich alle wie die Kälber abschlachten lassen, es habe keine bewaffnete und organisierte Gegenwehr gegeben. Arno Lustiger hat bewiesen, daß das eine Geschichtslüge ist. In den ersten Jahren nach 1945 war dieser Streit unter den Juden in Israel eine offene Wunde. Manche dort geborene „Sabres“, taffe Zionisten, verspotteten die Überlebenden, die aus Europa in Erez Israel ankamen: „Ihr seid eben Opfer! Selber Schuld, ihr >KZniks< ! Ihr hättet schon vor der Shoah zu uns kommen sollen! Wir hier sind die Kämpfer“
Meine poetische Transportarbeit am Katzenelson-Material kostete zwei Jahre. Für mich war diese Arbeit ein Gedenken an meine Mischpachá. Und sie war ein Freundschaftsdienst für den Historiker des Jüdischen Widerstands. Der junge Arno Lustiger hatte vier Jahre Auschwitz, dann Buchenwald überlebt und am Kriegsende sogar noch das KZ Langenstein im Harz, wo die Juden im Bergwerk in den stillgelegten Stollen unterirdische Fabrikhallen bauen sollten und neue Stollen in die Thekenberge treiben für die Produktion von Hitlers ersehnten Wunderwaffen zum Endsieg: Raketen und Flugzeuge.
Sie befördern mit Ihrem Marion-Samuel-Preis die lebendige Erinnerung. Die Kultur des Gedächtnisses und des Gedenkens ist alt wie die Menschheit: Das Humanum Memoria. Die Geschichte des homo faber, vermute ich, begann zugleich mit dem homo memoriae. Wir gedenken unserer Toten, unserer Taten und Untaten, damit wir aus der Vergangenheit eine Linie ziehn können zu einem Punkt in eine Zukunft. Nur so leben wir ja eine humane Gegenwart.
Und wenn wir erlittenes Unrecht nicht vergessen, die Massaker, die Pogrome, die Unterdrückung in den finsteren Zeiten dieser oder jener Diktatur, dann hat das immer auch einen praktischen Gebrauchswert: es soll uns wachsamer machen und scharfsichtiger für die allerneuesten Erfindungen der Barbarei, mit denen wir selbst es nun grade zu tun haben. Das müssen nicht immer Gaskammern und nicht altmodische Massengräber sein, in die Menschen reingeschossen werden wie es geschah, 1941 in Babij Jar. Uns erschüttern auch soziale und ethnische Konflikte, wir erleben kalte Verteilungskriege auf dem Weltmarkt und die heißen Religionskriege. Es sind immer innovative Herausforderungen, die ja die unsterbliche Tyche, die griechische Göttin des Schicksals, die Göttin der glücklichen oder bösen Fügung und des Zufalls für jede Epoche neu bereit hält. Die Büchse der Pandora ist deshalb für jede neue Generation eine Wundertüte.
Mich spornt die Ehrung in Augsburg mit dem Marion-Samuel-Preis an, auch im Alter mich als „Zoon politikon“ zu bewähren. Ich war nie Apokalyptiker , aber es ist eine reale Gefahr geworden, daß unsere Gattung Mensch sich ausrottet. Die A- B- und C-Waffen haben uns die Technik für solch einen globalen Selbstmord geliefert. Das ist neu in der Weltgeschichte. Der Erde wäre es egal, ob Menschentierchen wie wir auf ihr rumlaufen. Aber schade um uns wäre es doch. Ich denke nur an Blitz-Schach und an das Spiel der Geschlechter, an Rioja-Wein und den Hamburger Fußball-Club FC St. Pauli und an meine klassiche Caprice-Gitarre von Claus Voigt.
In jeder Nachrichtensendung und in den Talk-Shows geht es jetzt um den Kampf gegen die Armee des Islamischen Staates, um einen großen Krieg, der zu gewinnen ist, aber offenbar nur im Bündnis mit dem Terroristen Assad und ähnlichen Menschenfeinden. Und alle Welt weiß, daß dieser blinde Augenarzt in Damaskus, der in England Medizin studierte, sich nur gegen sein Volk an der Macht halten kann, weil der verblendete Zar Wladimir Putin ihm die Treue hält, mit Waffenlieferungen und mit Vetos in der UN, und nun auch mit modernen Düsenkampfbombern. Wir erleben es zumindest an der Glotze, daß Putin auf der Krim und im Oblast Donezk einen Heißen Krieg gegen die Ukraine führt. Aber wir erkennen auch, daß ohne oder gar gegen diesen Brandstifter, das Höllenfeuer in Syrien und in Mesopotamien nicht zu löschen ist. Globale Politik ist eben kein Ethik-Seminar für Anfänger.
Europa ist wie gelähmt und zerrissen auch im Streit um die Flüchtlings-Lawine. Es ist schade, daß wir das jüdische Mädchen Marion Samuel nicht nach seiner Meinung fragen können, denn die Namensgeberin des Augsburger Preises könnte heut noch leben. Sie wäre jetzt nur 5 Jahre älter als ich.
Ich bilde mir ein, daß sie sagt: Ihr Deutschen habt eine ermutigende Erfahrung gemacht. Der Hitlerkrieg endete damit, daß immerhin 12 Millionen abgerissene Kriegs-Flüchtlinge im total zerstörten Rest des Deutschen Reiches aufgenommen und integriert wurden. Natürlich kamen nur deutsche Landsleute und waren außerdem Christen. Aber viele waren auch deformiert, moralisch entkernte Opfer, devote Allesmitmacher, verhetzte Denunzianten, abgerichtete Folterknechte, fanatisierte Mörder. Das Deutsch, das die Heil-Hitler-Deutschen auf der Zunge hatten, war die vergiftete Sprache des Dritten Reiches , die Viktor Klemperer LTI nannte, also Lingua Tertii Imperii. Und weil jeder sich der Nächste ist, war die christliche Nächstenliebe der meisten Flüchtlinge aus Ostpreußen und Schlesien und aus den Sudeten geschrumpft zum aggressiven Selbstmitleid.
Die allermeisten Flüchtlinge, die jetzt ankommen sind aus dem Bürgerkrieg brutal ins Exil gejagte Menschen in Not. Und es sind nicht nur vitruvianische Modellmenschen. Viele sind traumatisiert, etliche unter ihnen religiös indoktriniert, intolerant und politisch verwüstet. Aber wir wollen trotzdem nicht die eigentlichen Opfer mit den wahren Tätern verwechseln: Das Gros der Flüchtlinge ist auf der Flucht vor dem Krieg totalitärer Fanatiker, die systematisch ihr eigenes Volk abschlachten. Die meisten wollen hier eine neue Existenz sich erarbeiten, so wie einst die Auswanderer aus ganz Europa auf dem Weg ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In Amerika lernten sie dann schnell, daß es auch dort Grenzen gibt, daß man vieles umdenken, vieles umfühlen und auch in der Demokratie hart arbeiten muß.
Gewiß: Geschichte wiederholt sich - jedoch niemals einfach. Und darum gibt’s auch keine Lehren aus der Vergangenheit als Standard-Rezept. Aber das war immer so: in wirklich tragischen Konstellationen - also auch in unserer Flüchtlingsfrage - kann der Mensch im Privaten wie im Politischen nur wählen zwischen zwei Fehlern. Falsch ist da ja alles. Es gibt eine Goldene Regel im Überlebenskampf: Unser deutschester Dichter Friedrich Hölderlin lieferte sie uns, kurz bevor er in den dunklen Tunnel der elend langen Zweiten Hälfte seines Lebens geriet, in der hellsichtigen Hymne „Patmos“. Da stehn die zwei Zeilen
„Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch
Dieses Wort könnte unserer Kanzlerin Angela Merkel ein Kompaß sein, wenn sie tapfer auf ihrem risikoreichen Kurs bleibt, den ich für richtig halte:
Wir schaffen das!
__________________________________________________
Gräber
1. Auf Kreta fand ich ein' Friedhof
Für Führer und Vaterland
Da schlafen viel deutsche Soldaten
Im Hügel am Straßenrand
Und über ihnen wuchert
Der gelbe Rosinenwein
Zu süß! der Wein für Rosinen
Den stopfte ich in mich rein
2. Und auf Formentera da wohnen
Die Toten bequem direkt
Am großen Auto-Friedhof
Das hat mich ein bisschen geschreckt
Wie Krieger mit ihren Waffen
So liegen die Toten bereit
Mit ausgeschlachteten Autos
Zur Fahrt in die Ewigkeit
3. In Moskau der Nonnenfriedhof
Da liegen mit Bildchen und Stein
Die Mörder und ihre Opfer
Sie liegen Gebein an Gebein
Und fluchen und wimmern und stoßen
Und kratzen einander wund
Und schrein mit blutiger Erde
Im aufgerissnen Mund
4. So graste ich manches Grab ab
Fraß Blumen verwelkt in mich rein
Und lud mir auf die Seele
In Prag einen Juden-Stein
Die Toten leben ganz eigen
Sie reden so still und klar
Sogar ihre Lebenslügen
Werden im Schweigen wahr
5. Ich weiß es, die Toten leben
Und wolln, dass sie einer besucht
Wer kalt an den Kalten vorbeigeht
Der wird verhext und verflucht
- ich nicht! meines Vaters Grabstein
Steht überall. Ich brauch
Sein Grab nicht lange suchen
Es ist so leicht zu finden
- dort, wo ein Schornstein raucht
***
BALLADE VON JAN GAT
UNTERM HIMMEL IN ROTTERDAM
1
Und als der Krieg noch jung und frech
Und blitzkriegefröhlich war
Da brach die Wehrmacht in Holland ein
Das war im Vierziger Jahr
Ein Bombengeschwader hat über Nacht
Halb Rotterdam ausradiert
Das Feuer leckte die Holzhäuser weg
- dem Hafen is nix passiert
2
Doch die tote Stadt stand nach dem Krieg
Wieder auf und ward gesund
Wo sich der alte Vater Rhein
Erbricht wie'n kranker Hund
Steht groß am Kai ein Monument
Das heißt "De verwoeste Stad"
Die Leute aber in Rotterdam
- die nennen den Kerl "Jan Gat"
3
Jan Gat reißt die leeren Hände hoch
Als wär wieder Fliegeralarm
Grad als ich ihn traf, flog über ihn weg
Ein schreiender Möwenschwarm
Und hoch im Blau ein weißes Netz
Aus Wolkenfäden gemacht
Der Himmel wird über Rotterdam
- von Düsenjägern bewacht
4
Jan Gat, ich kenne die alte Furcht
Ich komm ja aus Hamburg her
Da bin ich gekrallt an meine Mama
Geflüchtet durchs Flammenmeer
In Hammerbrook durch den Kanal
Sind wir ins Freie geschwommen
Durchs Fegefeuer der Bombennacht
- so sind wir dem Tod entkommen
5
Und weil ich unter dem Gelben Stern
In Deutschland geboren bin
Drum nahmen wir die englischen Bomben
Wie Himmelsgeschenke hin
Wir hatten Schwein, du auch, Hans Loch
Wir hatten mehr Glück als Verstand
Bloß machen zwei halbe Schweine noch
- kein ganzes Vaterland
6
Da sprach Jan Gat: Ja, ich versteh
Wir hatten wohl Glück. Jedoch
Wo einst mein großes Herz schlug, ach
Da klafft nun ein Riesenloch
- mensch Jan, drum heißte ja auch Hans Loch
Sprach ich, das geht O.K.
Sei froh! Was du verloren hast
- das tut dir auch nie mehr weh.
___________
[Monumentale Skulptur von Ossip Zadkine: „Die verwüstete Stadt“.
Sie steht in Rotterdam. Das niederländische „Gat“ bedeutet: „Loch“]
Meine ostwestliche Milchstraße
- einst über der Insel Usedom entdeckt, und wieder
im Lande Angeln, an der Flensburger Förde
Nicht oft - doch manchmal sah ich schon den Sternenhimmel
So klar und groß und gut – zuletzt vor vierzig Jahrn
Da krümmte sich die Insel Usedom ums Achterwasser
Und ich ließ in die Nacht mich treiben mit dem Boot
Da stehn nicht Häuser rum, es stört den Blick kein Baum
So große Himmel wachsen bloß auf großen Wassern
Alleine auf dem Fischerkahn der beiden Brüder Wolff
Im Lieper Winkel, windstill war die Nacht, ich lag
An Deck auf einem Haufen trockner Reusen-Netze
Am Wasserkasten, wo zwei Zentner Zander tobten
Soff ich mich satt am Licht im schwarzen Firmament
Galaxis heißt das Zauberwort, verschüttet Sterne wie
Ein Krug voll Himmelsmilch. Mir schmeckte die Methapher
Mit allen Sinnen leckte ich Natur als wär es Poesie
Jetzt bin ich alt, nun staunen meine schwachen Augen
Mit Brille schwer bewaffnet dieses Schauspiel an
Im Westen find ich auch den Nordstern vorn am Wagen
Die Deichsel. Seh den Flieger Richtung Kopenhagen blinken
Der Orion steigt auf, da aus dem Wald. Der Große Jäger
Im Winter nur streift er von Habernis hoch über´s Moor
In Richtung Roikier. Und ich seh im Sternbild blitzen
Des Gottessohnes Schulter mächtig leuchten: Beteigeuze
Den Riesenstern, - der ist so groß, daß in ihn passen würden
Die Sonne, die Planeten, Deutschland einig Vaterland
Dein Herz dazu und meins, die passen beide noch mit rein
Und zwischen uns auf Erden hier der kalte Weltraum auch
Ich seh den Gürtel - die drei schrägen Sterne - drunter klein
Sogar sein Kurzschwert, wie´s ihm schimmert vor dem Bauch
Heut spieln sie bass verrückt, die Sterne über mir
Werweiß! vielleicht vergaß ich das moralische Gesetz
In meiner Brust. Verlockend, frech verführerisch
Erscheinen mir, zum Greifen nah, die Himmelskörper
Wie reife Früchte, die ich einfach pflücken könnte
Leicht, wenn ich nur beherzt genug nach ihnen greife
So stellte ich mich eben auf die Zeh´n und wollte
Für meine Liebste wenigstens den Beteigeuze-Stern
Herunterreißen, und nicht immer bloß mit Liedern
Als ausgetrickster Orpheus singen in der Unterwelt
Und plötzlich ruft ´ne innre Stimme: Nein! Laß sein!
Mensch, alter Barde, grade ist das Pflücken schon
Nur eines Apfels dir in Altona am Teich mißlungen
Fatal! So Eskapaden passen besser zu den Jungen !
Papperlapapp! Was paßt denn schon zu wem in welcher Zeit
Die Sterne leuchten, ganz egal, ob Ost ob West
Ich bin Methusalem. Im Mutterleib schon war ich Greis.
Dreitausend Jahre alt war ich, von Anfang an
Und bin nun mal ein Glückskind, denn mein Judenstern
Hat mich bewacht. Mir lebn ejbik! Ich bin der Beweis:
Mich schoß kein Mörder in das Massengrab in Minsk
Ich starb in keinem Duschraum ohne Duschen. Und verbrannt
In Hamburg unterm Bombenteppich bin nicht ich
Als ich auf Mutters Rücken den Kanal in Hammerbrook
Durchquerte, waren wir vom Rauch schwarz überweht
Ein Riesentotentuch, das reichte für die ganze Stadt
Mir reicht es, daß ein Gelber Stern am Himmel steht
Den Rosi Biermann am Pilatuspool sich angeheftet hat
_____________________________
Wolf Biermann über Bertholt Brecht
Ekel und Genie • Essay •
Werner Hechts Biografie über Bertolt
Brecht zeigt einen wankelmütigen Helden
Ekel und Genie • Essay •
Werner Hechts Biografie über Bertolt
Brecht zeigt einen wankelmütigen Helden
Dieser Dichter hat für mich das Kaliber von Shakespeare und Goethe und Villon, als Dramatiker fast sogar den Rang von Georg Büchner. Lieben muß man dieses geniale Ekel. Anders ist er für unsereins nicht zu ertragen. Ansonsten gilt auch für ihn selber sein salopper Spruch: „Kein Mensch hält ewig, einige halten etwas länger.“
Brecht-Portrait von Rudolf Schlichter, um 1926
Brechts Beispiel hat mich 1956 verführt und bis heute geprägt.
Ich selbst habe den Brecht nie im Leben getroffen. Aber kurz nach seinem Tode gab mir seine Frau, Intendantin Helene Weigel, die Chance meines Lebens. Ich durfte ab 1957 bis 1959 an Brechts Theater lernen und arbeiten.
Ohne die „Mutter Courage“ des Berliner Ensembles hätte ich hochwahrscheinlich nie im Leben ein einziges Gedicht oder gar Lied geschrieben.
Der von den Nazis verjagte Dichter Brecht wollte nach dem Kriegseine großen Theaterstücke aus den Koffern des Exils endlich auf deutschen Bühnenbrettern ausprobieren. Aber eine Chance für sein Projekt bot ihm nicht Österreich, nicht die Schweiz oder die Bundesrepublik , sondern nur die DDR, damals noch SBZ, die Sowjetische Besatzungszone.
Also ging er mit Kind und Kegel und allen Manuskripten nach Ostberlin. Im Westen wurde er damals boykottiert und als Kommunist geächtet.
Allerdings tobte zu dieser Zeit in Ostberlin selbst ein Krieg. Es war der Kleinkrieg zwischen dem avantgardistischen Theatermann aus der großen weiten Welt und den spießbürgerlichen Kulturbonzen im Parteiapparat. Die Parteioberen in Ostberlin waren, was Brecht betrifft, hin- und hergerissen. Der Brecht galt ihnen als ein „Genosse ohne Parteibuch“. Die treuen Betonköpfe hielten ihn für einen bolschewistelnden Hallodri, für einen bürgerlichen Bohémien, für einen westlich-dekadenten Formalisten und gefährlichen Jugendverführer. Stimmt ja auch: Auch mich hat sein Beispiel im allerbesten Sinne gestachelt.
Aber im Prestige-Ringen mit dem westdeutschen Klassenfeind um prominente Köpfe, schluckten die Obergenossen die giftige Kröte. Sie verfochten im innerdeutschen Klassenkampf gegen Adenauer ihren kommunistischen Anti- Alleinvertretungsanspruch. Im Grunde fanden sie den heimgekehrten Dramatiker zum Kotzen und hielten ihn für eine „konterrevolutionäre“ Gefahr.
In seiner kürzlich publizierten Biographie Bertolt Brechts zitiert der Theater- und Literaturwissenschaftler Werner Hecht, Jahrgang 1926, zu diesem Interessenskonflikt noch einmal die diplomatischen und dennoch wahren Worte der Helene Weigel, die sie ihm 1969 ins Tonband diktierte:
„Sie haben´s im Großen und Ganzen gelitten.
Wir waren doch nicht ganz das, was sie wollten,
aber sie wollten nicht verlieren, was sie mit uns hatten.“
Hecht – vulgo der „Brecht-Hecht“ – ist gewissermaßen das Faktotum der traditionsreichen Brecht-Familienfirma. Nach Brechts Tod war auch er ans Berliner Ensemble geraten und arbeitete unter den Fittichen von Helene Weigel, als Dramaturg. Er blieb bis 1974 beim Theater und wurde später zum Mitherausgeber der Brecht-Gesamtausgabe.
Über jedem DDR-Kindergarten stand geschrieben, über jeder NVA-Kaserne, jeder Ost-Uni, über jedem Volkseigenen Betrieb, also über dem ganzen „Arbeiter- und Bauernstaat“ stand damals die Staatsraison: „Von der Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen!“ – Stalin und seine Nachfolger spielten eben Gott: Die Beute des Krieges sollte nach ihrem Ebenbilde geformt werden.
Und dies galt auch für das neue Theater im Osten. „Stanislawski-Methode“ wurde im Kulturkampf das aufreizende Streitwort. Das sowjetische Stanislawski-Theater, also die „volkstümliche“ Schauspielkunst der „Einfühlung“ galt in der DDR als verbindliches Vorbild. Brecht fand das sowjetische Theater „tümlich“ . Aus seiner Perspektive war die obligate Schauspiel-Ästhetik aus Moskau ein veraltetes, spießiges, ein feudal-bourgeoises, ja ein reaktionäres Illusionstheater. Und er wehrte sich mit den Waffen seiner moderneren Theorie und Bühnenpraxis des „epischen Theaters“ gegen den Dogmatismus der devoten SED-Ideologen.
Von 1949 an, als eine Art Untermieter unterm Dach des Ostberliner „Deutschen Theaters“, des damaligen DDR- Staatstheaters, spielte Brecht fünf Jahre lang mit seinem von ihm und Helene Weigel gegründeten Berliner Ensemble. Dann genehmigte die Partei dem erfolgreichen BE endlich ein eigenes Haus. Zufällig ergatterte Brecht das neubarocke Schiffbauerdamm-Theater aus dem 19. Jahrhundert, an dem 1928 der Regisseur Erich Engel Brechts „Dreigroschenoper“ uraufgeführt hatte.
Mit einigem Abstand gesehen (und auch von Brecht selber am Ende gelassener): Der Streit mit den Stanislawski-Anhängern stank nach „Religionsdisput“: Viel ideologische Eitelkeiten, eifernde Unkenntnis, wortreiche Rechthaberein um den einzig richtigen Theater-Glauben. Ja, „gestunken ...“, wie es bei Heinrich Heine heißt, haben sie beide. Im Grunde ging es gar nicht um irgendeine modernere Spielweise, sondern um die Wurscht, oder mit Brecht: „ ... um die Kohle, um das Erz und / und die Macht im Staat.“ Und es ging um die uralten Schwierigkeiten beim Schreiben und Sagen gefährlicher Wahrheiten in einer Diktatur.
Werner Hecht liefert uns Lesern dazu eine kleine Kriegs-Chronik der verdeckten Schlachten und sinistren Attacken, der innerparteilichen Scharmützel und terroristischen Überfälle. Ein lehrreiches Kapitel ist etwa die SED-Kampagne gegen die Aufführung der Brecht/Dessau-Oper „Das Verhör des Lukullus“ im Jahr 1951. Ein groteskes Kapitelchen ist die Attacke von Erich Honecker (damals noch Chef der FDJ) gegen Brechts Propaganda-Kantate „Herrnburger Bericht“ 1951. Ein tragisches Hauptkapitel dagegen: Hanns Eislers Desaster beim Versuch, „ ... mit dem Volk auf Du und Du“ den Deutschen einen plebejischen Anti-Goethe-Faust zu dichten und die kommunistische National-Oper „Johann Faustus“ zu komponieren.
Dann ein für mich herzzerreißendes Kapitel: Brecht und der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953. Brechts tapferfeige Ergebenheitsadresse für Stalins Quisling Walter Ulbricht am 21. Juni 1953 im Zentralorgan der SED Neues Deutschland – und als Kontrapunkt, zugleich nur für die Schublade geschrieben, Brechts böses Spottgedicht auf Ulbricht & Co mit der ungeheuerlichen Pointe: „Wäre es da / Nicht doch einfacher, die Regierung / löste das Volk auf und / Wählte ein anderes?“
Hecht verwendet als Untertitel seines Buches passend den Slogan aus des Dichters Epigramm „Wahrnehmung“ , geschrieben im DDR-Gründungsjahr 1949: „Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns / Vor uns liegen die Mühen der Ebenen.“
So liefert Hechts Brecht-Buch ein lehrreiches Sittengemälde der frühen DDR, ein Panorama, das mich an Hieronymus Bosch erinnert, an all die surrealen Monster in dem Bild „Die Versuchungen des heiligen Antonius“. Nun also die Versuchungen des unheiligen Bert Brecht mit den realen Monstern aus der stalinistischen Hölle. Was trieb er? Was trieb ihn? War der Clinch eine Umarmung? War der taktische Opportunismus eine strategische Finte der Revolution? Feigheit, oder die List der Vernunft? Plebejischer formuliert: Kann man einem Drachen in den Arsch kriechen und ihm dabei von innen die Gedärme zerbeißen?
Das Brecht-Image, bei Kurzzeitgeistlern in Ost und West, ist verblichen. Manche haben seit dem Zusammenbruch des Welt-Kommunismus die Ikone des Kommunisten Brecht sogar zertrümmert. Ich nicht. Mich grämt diese Exkommunikation, denn der Dichter war keineswegs eine Canaille der DDR-Diktatur.
Brecht stempelte korrumpierte Intellektuelle ab, die sich an die Herrschenden verkauft haben, mit dem Schand-Anagramm „TUI“. In seinem „Buch der Wendungen“ verfremdete Brecht die Dramatis Personae mit chinesisch kaschierten Decknamen und Kostümen. Brecht stellte die Bemänteler der Heuchelei bloß. Er spottete über die geistigen Speichellecker des Fürsten, entlarvte die gekauften Apologeten als „Weißwäscher“.
Als einen „TUI“ („Tellekt-Uell-In“ ) beschimpfen allerdings immer wütender auch viele Nachgeborene den Dichter selbst. Kein Wunder: Ein Jahr nach Stalins Tod, 1954, straften die Götter den Brecht mit dem sowjetischen „Stalin-Friedenspreis“. Und unser Meister war so dummschlau, ihn anzunehmen.
Mein vertrauter Arzt in Ostberlin, der Internist Georg Tsouloukidse, betrieb eine die Praxis am Schiffbauerdamm. Dieser zuverlässige Freund „Goggi“ hatte den Brecht gelegentlich ambulant medizinisch betreut. Und er behauptete später steif und fest, daß der Brecht, bei korrekter medizinischer Behandlung und Pflege, leicht noch 20 Jahre auf Erden hätte weitermachen können.
Ich bilde mir seit ewig ein, zu wissen, warum dieser Brecht 1956, statt sich ins Bett zu legen, dermaßen selbstmörderisch weiter am Theater arbeitete. Er verbiß sich in Erich Engels hochproblematische Proben mit Ernst Busch für das Sück „Leben des Galiliei“. Die Gretchenfragen um die Atombombe. Das vermute ich: Brecht hatte damals das Leben als kommunistischer Prediger satt.
Im welthistorischen Sinne „Schuld daran“ war der neue Parteichef im Kreml. Im Februar dieses Jahres 1956 brach mal wieder eine neue Zeitenwende über uns herein. Auf dem XX. Parteitags der KPdSU wagte der stalinistische Antistalinist Chruschtschow eine Art Staatsstreich. Der sowjetische Skinhead hielt eine Geheimrede über die monströsen Menschheits-Verbrechen der Stalinzeit.
Diese grauenhaften Wahrheiten über das gelobte Land des Kommunismus blieben nicht geheim. Millionen schuldloser Sowjetbürger, grauenhaft bevorzugt jüdische Kommunisten, waren von ihren Genossen ermordet worden in den Folterfabriken des KGB. Mehr als sechs von zehn deutschen Kommunisten, die es in der Nazizeit geschafft hatten, sich aus Hitlerdeutschland in die UdSSR zu retten, wurden damals dort liquidiert. Zwei konträre Monster der KPD, Walter Ulbricht und Herbert Wehner, überlebten diese Höllen. Und wir wissen inzwischen wie.
Die Nachrichten über den GULag waren ein Schock für Kommunisten in aller Welt. Und genau im Spätsommer dieses Schicksalsjahres hat unser Brecht sich davon gemacht in den Tod. Er war im allerbesten Sinne demoralisiert. Unser Menschheitsretter hatte seine Rolle als Weltweiser für die kommunistische Endlösung wahrscheinlich selber satt. Der erschöpfte Brecht wollte in das private Paradies auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in der Chausseestraße einziehen.
Seinen Nachruhm hielt er für gesichert. Unser „großer Lehrer“ verkroch sich in seinen Plüschsarg aus sieben rostfreien Edelstahlschichten. Mit Heines Wort gesagt: Bert Brecht desertierte damals aus dem „Freiheitskrieg“ der Menschheit.
Der marxistisch-leninistische Lehrer hatte die historische Lektion gewiß tiefer begriffen als wir roten Greenhorns. Radikal, wie Brecht immer gewesen war, hätte grade er nun, mit dialektischer Tollkühnheit, aus der Partei, deren formales Mitglied er nie gewesen war, in aller Form und öffentlich austreten müssen. Wir, seine Schüler, hätten ihn gefeiert mit einem Zitat aus seinem eigenen Galilei-Stück: „So viel ist gewonnen, wenn nur einer aufsteht und NEIN sagt!“
Seine Trennung von der Bourgeoisie hatte Brecht Ende der Zwanziger Jahre knallhart durchgezogen, lange vor der Nazizeit. Sein zynisches Lehrstück „Die Maßnahme“ aus dem Jahre 1932 ist die abstoßende Wegmarke. Nun aber, am Ende der Stalinzeit, hätte Brecht zum zweiten Mal radikal brechen müssen. Und dieses mal eben mit dem Kommunismus.
Brecht hätte ein tapferer, ein guter Renegat werden müssen, so wie etwa in den Dreißiger Jahren seine kommunistischen Genossen Arthur Köstler und Manès Sperber, so wie eine Generation später auch sein Nachgeborener Wolf Biermann.
Tja - könnte ich jetzt im Nachhinein den Brecht rückwirkend ermutigen und verführen mit meinem Lied „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“!! Aber damit hätte ich ihm wohl auch nicht nützlich werden können, denn genau das wußte der ja selber. Im amerikanischen Exil schrieb Brecht, das war 1942:
Sah, verjagt aus sieben Ländern / Sie die alte Narrheit treiben:
/ Jene lob ich, die sich ändern / Und dadurch sie selber bleiben.
Er selber allerdings brach nicht mit seiner eigenen alten Narrheit. Es ist zum Lachen, zum Weinen sowieso.
Ach! wenn Brecht in seinem Todesjahr seinen zweiten Lebensbruch gewagt hätte! Was wäre dann aus uns Brechtianern geworden? Was aus seinem stärksten Schüler Heiner Müller? Was aus seinem schwächsten, dem parfümierten Salonkommunisten Peter Hacks? Was aus der tiefen Flachdenkerin Christa Wolf? Was aus dem ängstlichen Kraftprotzpoeten Volker Braun? Was aus der plebejischen Dichterin Helga M. Novak? Was aus meinem Herzensbruder dem melancholischen Lyriker Günter Kunert? Und was aus mir?- vielleicht kein jüdischer Spottvogel, der das Weltende-Liedchen des Jakob van Hoddis vollendet. Und was wär geworden aus mir?
Doch nun okkupiert mich eine Überlegung, für die mir bis jetzt vielleicht nur der Mut fehlte. Alles Palavern über Brecht: „er hätte lassen können“, „er hätte wollen sollen“, „er hätte tun können“, sie sind eitel und Haschen nach Wind: Unser verehrter Meister, der konnte den Bruch mit dem Kommunismus ja gar nicht wagen! Warum? Menschenskind! Brechen kann man nur mit einer Haltung, die man wirklich hat.
Ich hab also vielleicht etwas unerhört Neues für Sie, lieber Werner Hecht: Unser Brecht, er war nie ein Kommunist.
Wolf Biermans Ermutigung an Vitali Klitschko
Wolf Biermans Ermutigung an Vitali Klitschko
Text und Unterzeichner
Lieber Vitali Klitschko,
weil wir Sie kennen und schätzen, senden wir Ihnen persönlich ein paar Worte der Ermutigung an all die Menschen, die jetzt in der Ukraine für wahre Demokratie und gegen die falsche, die „lupenreine Demokratie“ à la Putin und Janukowytsch, so tapfer kämpfen.
Auf vielen Kontinenten tobt der ewige Freiheitskampf, der seit Generationen in immer neuen Kostümen und historischen Kulissen ausgefochten wird. Aber die Ukraine ist hier in Europa unser Nachbar, und also berührt dieser Streit viel direkter auch unsere eigenen Interessen und unser Schicksal.
Heinrich Heine - der wohl deutscheste all unserer großen Dichter - schrieb im französischen Exil, in Paris des Jahres 1851, seine politische Lebensbilanz „Enfant Perdu“. Der Poet nennt sich da ein verlorenes Kind und zugleich einen treuen Kämpfer im ewigen Freiheits-Krieg.
Dieser Krieg um Freiheit und um die Freiheiten ging immer wieder verloren, und er wurde trotzalledem immer neu gewagt, in wechselnden Zeiten der Menschheitsgeschichte.
In diesen Tagen tobt der Freiheitskrieg in der Ukraine - und nicht nur auf dem Majdan-Platz in Kiew. Wir Deutschen erleben diesen Kampf nur am Fernsehapparat, so wie sonst Ihre Boxkämpfe. Wir bestaunen und bewundern, dass dieser ukrainische Weltmeister mehr kann als mit den Fäusten sprechen. Bitte wirken Sie weiter - als Patriot der Ukraine und zugleich Europäer - im Sinne einer völkerverbindenden „Bridge over Troubled Waters“. Und übermitteln Sie bitte Ihren Freunden in Kiew diese erste Strophe des Heine-Gedichtes:
Enfant Perdu
Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfte ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.
Aber vollenden Sie diesen Vers heute in der ukrainischen Wirklichkeit weniger pessimistisch als damals unser exilierter Poet in seinem Gedicht. Sie stehen ja zum Glück nicht auf verlorenem Posten.
Wir hoffen mit Zorn und Bangen, dass die Hoffnung auf einen unblutigen Sieg Ihnen und Ihren Freunden in Kiew nicht verloren geht. Alle, sogar auch die missbrauchten Polizisten des diktatorischen Regimes, sollen, anders als im Heine-Gedicht, wieder gesund nach Hause kommen.
Wolf Biermann, am 04. Februar 2014
Omair Ahmad, Martin Ahrends, Prof. Dr. Omar Akbar, Fadhil Al-Azzawi, Dr. Lindita Arapi-Boltz, Homero Aridjis, Dieter Bachmann, Güner Yasemin Balci, Dr. Jochen Balkhausen, Andreas Bauer, Wilhelm Baum, Prof. Christian Beldi, Dr. Tania Beldi, Charles Bernstein, Andreas Bertram, Stephan Bickhardt, Pamela Biermann, Marianne Birthler, Manfred Bissinger, Marica Bodrozic, Heidi Bohley, Kalle Bohley, Dr. Martin Böttger, Pam Brown, Thomas Brussig, Hans Christoph Buch, Ian Buruma, Sabine Callies, Amir Cheheltan, Thierry Chervel, Daniel Cohn-Bendit, Philippe Coutelen, Ernst Demele, Gabriele Dienst, Christian Dietrich, Lidija Dimkovska, Frank Ebert, Manuel Edler, Katrin Eigenfeld, Tahsin Erkan, Ashur Etwebi, Petra Falkenberg, Péter Farkas, Sherko Fatah, Prof. Dr. Norbert Finzsch, Dr. Bernd Florath, Rainer Fornahl, Peter Franke, Helmuth Frauendorfer, Ute Frevert, Ralf Fuecks, Werner Fuhr, J.G. Gaarlandt, Klaus Gabbert, Dr. Anja Gerecke, Prof. Dr. med. Dieter Gerecke, Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Gerhardt, Jochen Gerz, Matti Geschonneck, Kerstin Gierke, Christian Girod-David, André Glucksmann, Matthias Goeritz, Georg Goosmann, Bettina Gräf, Roman Grafe, Gintaras Grajauskas, Birgit Grätz, Steffen Gresch, Dr. Christian Grote, Lars Gustafsson, Dr. phil. Christian Halbrock, Klaus Harpprecht, Renate Harpprecht, Robert Hass, Frank Herterich, Dr. Norbert Hilbig, Gerold Hildebrand, Ralf Hirsch, Thomas Hoepker, Dr. Gabriele Holoch, Monika Hörter, Dr. med. Waltraud Hörter-Volf, Stanka Hrastelj, Elke Hüge, Iman Humaydan, Roland Jahn, Sabrina Janesch, Elfriede Jelinek, Gudrun Jugel, Dr. Anna Kaminsky, Matthias Kämpf, Ralph Kessler, Julia Kisina, Burghart Klaussner, Jessie Kleemann, Thomas Klingenstein, Oliver Kloss, Sibylle Knauss, Gundel Köbke, Gerd Koenen, Harald Köhler, Günter Könsgen, Klaus Kordon, Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk, Krzysztof Krasiczynski, Ursula Krechel, Christine Kruchen, Dr. Olaf Kühl, Holger Kulick, Sonja Kurschildgen, Peggy Kypke, Dr. med. Wolf Kypke, Dr. Sabine Lehmann-Brauns, Dr. Uwe Lehmann-Brauns, Christoph Leisten, Michaela Leitner, Marjaleena Lembcke, Peter Lewandowski, Vasyl Makhno, Alberto Manguel, Marko Martin, Tienchi Martin-Liao, Rolf Mautz, Damodar Mauzo, Raffael Meininghaus, Helga Metzner, Hubertus Meyer-Burckhardt, Amanda Michalopoulou, Margit Miosga, Dr. Thomas Moch, Hala Mohammad, Dr. Klaus Mölln, Fanny Moreno, Dipl.-Ing. Karl-Ernst Müller, Birgit Müller-Wieland, Jan Müller-Wieland, Dr. Ingrid Mummert, Ban'ya Natsuishi, Dr. Ehrhart Neubert, Hildigund Neubert, Quito Nicolaas, Bahman Nirumand, Christina Nix, Prof. Dr. Christoph Nix, Johannes Nix, Dr. Alberto Noceti, Bernard Noël, Florence Noiville, Gesine Oltmanns, Ursula Ott, Julio Pavanetti, Cordula Peker, Dr. Stefan Peker, Dietger Pforte, Monika Platt, Thomas Platt, Elisabeth Plessen, Ines Plog, Prof. Jobst Plog, Liane Plotzitzka-Kämpf, Erika Pluhar, Martin Pollack, Jose Manuel Prieto, Eva Quistorp, Holly-Jane Rahlens, Waldemar Ritter, Prof. Dr. med. Henning Rohde, Tilman Röhrig, Doris Rosenkranz, Veronika Rotfuß, Carine Rüegg, Christine Rüegg, Hartmut Rüffert, Michail Ryklin, Dr. Helmut Salzmann, Walter Sänger, Sapphire, Agus R. Sarjono, Dr. Michael Schaaf, Roland Schäfer, Herrad Schenk, Agnès Schillinger, Andreas Schmidt, Peter Schneider, Kaspar Schnetzler, Dr. Anna Schor-Tschudnowskaja, Ulrich Schreiber, Christa Schuenke, Stephan Seeger M.A., Barbara Seiller, Dr. Rita Sélitrenny, Tom Sello, Barbara Sengewald, Matthias Sengewald, Denise Setton, Eduardo Sguiglia, Rajvinder Singh, Folker Skulima, Ostap Slyvynsky, Tzveta Sofronieva, Wolfgang Sofsky, Baby Sommer, Manuel Soubeyrand, Jens Sparschuh, Tilman Spengler, Michael Stognienko, Christine Storck, Matthias Storck, Ursula Swoboda, Annika Thor, Juliane Tief, Angela Tieger, Michael Turowski, Dubravka Ugresic, Amir Valle, Stefaan van den Bremt, Adriaan van Dis, Haris Vlavianos, C. Claus Voigt, Prof. Dr. Gisela Völger, Peter Völker, Christine von Arnim, Keto von Waberer, Prof. Dr. Karin von Welck, Michael von Welck, István Vörös, Ulrich Waller, Rolf Walter, Peter Wawerzinek, Gudrun Weber, Ian Wedde, Prof. Dr. Richard Weiner, Reinhard Weißhuhn, Sarah Wiederhold, Herbert Wiesner, Rainer Wochele, Wolf Wondratschek, Christoph Wonneberger, Elsbeth Zylla
Du bist schuld an allem! Und wir danken es Dir.
Rede zur Verleihung des Bertini-Preises
im Ernst-Deutsch-Theater. Montag, 26. Jan. 2014
Männlein wie Weiblein - liebe preisgeschmückte Schüler! Verehrte Lehrer beiderlei Geschlechts! Willkommene Nobilitäten unserer Hansestadt! Kleingeister und Großkopfete aus Kunst und Wissenschaft, angetörnte Zaungäste und abgetörnte Reiter auf den Holzpferdchen im Medien-Karussell! Am Ende der obligaten Arabeske: greiser Herzensbruder Ralph Giordano.
*
Vor 16 Jahren wurde dieser Bertini-Preis zum ersten Male vergeben. Und heute habe ich die Ehre, sollte lügen: das Vergnügen, eine kleine Festrede für dieses Jahr 2014 zu halten, im vertrauten, im sympathischen Ernst-Deutsch-Theater unter den Fittichen der schönen Intendantin Isabella Vértes-Schütter, hier also im plebejischen Mundsburger Winkel von Barmbek basch.
Es ist nicht meine Aufgabe, die ausgezeichneten Preisträger zu loben.
Die einzelnen Projekte der heute preisgekrönten Schülerinnen und Schüler werden sogleich von drei verschiedenen Lobrednern vorgestellt werden, die kurz und genau genug würdigen können, was da konkret zu loben ist.
Ich will heute zum ersten Mal einen Mann preisen, dem wir es überhaupt verdanken, daß es diese gute Tradition des Bertini-Preises in Hamburg gibt, seit nun schon sechzehn Jahren. Wir verdanken diesen Bertini-Preis dem pensionierten Pädagogen Michael Magunna.
Dieser Deutsch-Lehrer kam Anfang der 90er Jahre auf die Idee, einen solchen Preis für unsere Hansestadt vorzuschlagen. Der Lehrer hatte seinen Schülern im normalen Lehrplan für Höhere Schulen natürlich den weltbedeutenden Lübecker Heimatschinken „Die Buddenbrooks“ pädagogisch aufgeschnitten und serviert. Lehrer Magunna - zudem ein lebenslänglicher Goetheverehrer - hat seinen Kids in der Schule auch das Menschheitsdrama FAUST auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Goethes Hauptwerk verknüpft ja das fast noch mittelalterliche Volksbuch vom Schwarzkünstler Doktor Faustus im 16. Jahrhundert kunstvoll mit dem modernen Krimi seiner eigenen Epoche: Das plebejische Elend der Kindsmörderin.
Und ich sah vor 30 Jahren eine unerwartet starke, ja, fast professionelle Faustinszenierung, die dieser Lehrer damals mit den Schülern auf die Bühne seiner Schule gebracht hat.
Nun aber das Außerordentliche: dieser Magunna hat dann, und auf eigene Faust, mit seinen Schülern auch den Hamburger Heimat-Roman „Die Bertinis“ in seinen Lehrplan aufgenommen.
„Die Bertinis“ sind eine Art hanseatische Familiensaga. Sie spielt hauptsächlich im Tausendjährigem Reich, eine Story, mit einem jüdisch-italienisch-schwedischen, wie man heute korrekt sagt: Migrationshintergrund. Der Autor Ralph Giordano schildert in seinem Roman mit viel Wahrhaftigkeit und wenig Fabelei, was er selber im Hamburg der Nazizeit erlebte und wie er mit seiner kleinen Familie den Holocaust überlebte.
Ein Elite-Literat wie Thomas Mann würde über den Realismus seines Kollegen Ralph Giordano vermutlich Spott ausgießen. So giftete der Großschriftsteller mal über einen Nachwuchs- Romancier: „Man hat das peinliche Gefühl, der Autor hat wirklich alles selbst erlebt, was er da im Roman erzählt ...“ Das klingt nach einer Witzelei von Oscar Wilde. Soweit kannte ich den „guten Menschen von Köln“, Heinrich Böll: der hätte bei solchem Feuilleton-Schmäh den Kopf geschüttelt. Und ein ungnädiger Zeitgenosse wie Günter Grass wohl gegrinst. Neid und Bewunderung sind oft Zwillinge.
Die Mutter der Roman-Familie Bertini ist eine galizische Jüdin, wie es auch die wirkliche Mutter des Ralph Giordano war. Im Roman wie im Leben: Der Vater ein Hallodri, ein italienischer Mann am Klavier und in Hitlers Hamburg gefährlich „jüdisch versippt“. Und die drei Söhne dieser Eltern im tödlichen Schatten der Rassegesetze, sogenannte „Halbjuden“.
Ralph Giordano erzählt anschaulich und anrührend, wie er entkam, mit seinen Eltern und drei Brüdern.
Zwölf Jahre lang entging er den Deportationen und wurde auch nicht getötet unter dem Bombenhimmel im Inferno des Feuersturms „Gomorrha“, im Juli 1943. Mir selbst ist das alles vertraut und eingebrannt ins Gedächtnis. Diese Gefahren habe ja auch ich als ein Kommunistenkind und Judenbalg, als ein „Mischling Ersten Grades“ - hier in Hamburg-Hammerbrook überlebt.
Den Bombenkrieg der Alliierten gegen die Hitlerdiktatur verklarte meine kommunistische Mutter mir in Worten, wie ich sie verstand, als einen Freiheitskrieg: Die tödlichen Flugzeuge über uns – so flüsterte sie - waren not-wendig, denn sie sollten unsere Not wenden.
Giordano erzählt im Roman, wie seine kleine Familie gegen Ende des Krieges - mit knapper Not bis zum Einmarsch der britischen Armee - im Keller einer Ruine im abgebrannten Stadtteil Barmbek durchgehalten hat. Dieses Kunststück gelang nur, weil es auch in Hamburg in diesen finsteren Zeiten der Nazi-Diktatur Deutsche gab, die einen jüdischen Nachbarn nicht bei der Gestapo denunzierten, die den vogelfreien Juden sogar beistanden, mit Brotmarken, mit einem Versteck, mit ein paar Briketts und Kartoffeln - sei es mit einem tröstenden Wort, sei es mit Verschwiegenheit.
Michael Magunna, dieser leidenschaftliche Pädagoge, hatte die Botschaft des Romanautors Ralph Giordano offenbar nicht nur in die jungen Köpfe transportiert, sondern dabei auch selbst tiefer begriffen. Er besuchte mit seinen Schülern die Straßen und Plätze des Bertini-Romans, etwa so, wie die James-Joyce-Begeisterten am Bloomsday in Dublin auf den Spuren des Ulysses wandeln.
In Rostock und im Ruhrgebiet brannten nach dem Tod der DDR die Asylantenheime. Es gab „National befreite Zonen“ in Mecklenburg. So kam dem Lehrer der Einfall, in Hamburg einen Schüler-Preis zu begründen, der sich andockt an diese 800 Seiten lange Hamburgensie des hamburger Juden mit dem italienischen Namen. Und wichtiger noch: Magunna hatte außerdem das Geschick, die Nerven und das Beharrungsvermögen, seine Idee - gegen die Trägheit der Bürokratie - in die Tat umzusetzen. Das gelang ihm, weil er Mitstreiter fand, engagierte Schulkollegen, kluge Mäzene, ganz besonders den Literatur-Journalisten Hans-Jürgen Fink vom Hamburger Abendblatt. Ich lese Ihnen ein paar Sätze vor, aus des Deutschlehrers allererstem Schriftsatz an die Schulbehörde vom 14. September 1994. All das passierte vor 20 Jahren
Begründung meines Vorschlages zur Stiftung eines „Bertini-Preises“ durch die Freie und Hansestadt Hamburg
Ziel des Preises soll es sein, ein Verhalten von Schülern zu fördern und einzuüben, „politische und soziale Verantwortung zu übernehmen und im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken.“ (§2, Abs. 2.4 Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg vom 17. 10. 1977), indem sie aufgefordert werden, zu jeder Form von Rassismus und chauvinistischem Nationalismus im Bereich Hamburgs ... auf diese oder jene Weise tätig Stellung zu nehmen. Damit soll gemeint sein:
Beispiele für aktive Toleranz zu geben oder diese zu fördern; Beispiele für aktive Integration von Ausländern und Minderheiten zu geben oder diese zu fördern; innovativ und aktiv zu werden bei der Hilfe und Schutz bei Verfolgung und Diskriminierung in ihrem Gemeinwesen oder Hilfe und Schutz zu organisieren. - Man könnte dieses Ziel zusammenfassend mit „produktiver Zivilcourage“ für die im Grundgesetz verankerten Wertvorstellungen umschreiben, die noch den Grundkonsens unserer Gesellschaft darstellen.“
So lautete damals die Eingabe an die Obrigkeit, abgefaßt in einem verdorrten Deutsch, das auch Aktenschränke auf zwei Beinen verstehen.
Man könnte das Gemeinte auch lebendiger sagen. Im Grunde das Gleiche formulierte einst in Paris der deutscheste aller deutschen Dichter, Heinrich Heine . Der fand – was Wunder - eine schöne Formulierung. Der Poet nannte das, was der Lehrer Michael Magunna „produktive Zivilcourage“ nennt, in seinem Gedicht „Enfant Perdu“ kurz und bündig „Freiheitskrieg“, also den „Freiheitskrieg der Menschheit“.
Ja, verehrte Friedensfreunde, Sie haben richtig gehört: Krieg. Freiheitskrieg. Krieg ist ja eigentlich ein Schreckenswort. Ich will Ihnen verraten, wie Heine auf das elektrisierende Wort „Freiheitskrieg“ kam, er hat es mir in Paris vor kurzem erst verraten.
Ich besuchte meinen Meister nach Jahren mal wieder auf dem Friedhof am Montmartre und fragte: Wie kam ihnen die tolle Erfindung in den Kopf, ich meine die Zeile: „Verlorner Posten in dem Freiheitskriege // Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus ...“ ? Heine sagte: „ach, keine Erfindung! Das Doppelwort >Freiheitskrieg< kam schon gelegentlich vor! Und meistens stimmte an ihm nur der hintere Teil: Krieg. Denn die Freiheit, die da erkämpft werden sollte, erwies sich als Betrug, oder Illusion, als die Camouflage der nächst raffinierteren Form von Unrecht und Unterdrückung.
Ich habn meiner frühen Jugend erlebte ich - wie eine Offenbarung - in Düsseldorf den Kaiser Napoleon als Hegels Weltgeist zu Pferde ... und dann brachen ja die so genannten Freiheitskriege der Deutschen aus. Absurd! Diese Kriege gegen den Befreier Napoleon Bonaparte, eine Farce! Für uns Juden in Europa war und blieb dieser Imperator der Emanzipator, der ersehnte Befreier! Der Deutsche Michel aber wollte lieber schnarchen, wollte lieber von seinen vertrauten Fürsten geknechtet werden, statt von den frechen Franzosen wach geküsst. Im Singular aber des fatalen Wortes, wie ich es dann – am Rande der Matratzengruft in Paris - 1851 für meinen Gebrauch prägte: also im „Freiheitskrieg“ – da bedeutet dieses Zweiworte-Wort etwas Geistiges! Revolutionäres! und Erfreuliches! Ich meinte nämlich den ewigen Freiheits-Krieg der Menschheit gegen Unterdrückung, im Kleinen wie im Großen, im Privaten wie im Politischen. Und das ist ein wahrhaft heiliger und ist ein ewiger Krieg, den wir Menschen schon ausgefochten haben in der Steinzeit, dann in der Antike. Und wir kämpfen ihn aus bis heute. Das wird bis ans Ende der Welt so weitergehn.“
Heine redete sich in Rage: „Diese Binsenwahrheit hat sogar der geniale Fürstenknecht Goethe originell formuliert:
Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben,
der täglich sie erobern muß ...
Nun kam es mir vor, als ob die weiße Marmorstatue auf dem Grab wackelte. Heine geriet ins Predigen:
„ Freiheitskrieg! Ein ewiges Auf und Ab. Allerdings jedes mal neu inszeniert. In jeder Epoche rebelliert der alte Adam in neugeschneiderten Kostümen und mit moderneren Waffen, von der Steinschleuder über die Armbrust und Kanonen bis ...“ – da stockte Heine. Und ich ergänzte . „Von der Steinschleuder bis zur Atombombe und zum Computer.“ – „Computer? – Sie reden sonderbar irre!“ – Ich sagte: „Nein! Das Fernsehen schüttet uns jeden Tag eine Kanne digitales Blut, Menschenblut aus aller Welt, ins Wohnzimmer. In diesen Monaten tobt der Freiheitskrieg in der Stadt Kiew, in Afghanistan, in Thailand, in Ägypten, Afrika, in Russland ... in ... Und unsre schöne Hansestadt Hamburg ist gewiß keine Hölle, aber auch kein Paradies!
Sie kommen aus Hamburg?
Ich lebe dort, im schöneren Altona.
„Altona ...“ , seufzte der Heine auf: „Onkel Salomon, der Rothschild von Hamburg! Der reiche Sack! Der riesige Park! Der Mastenwald im Hafen! Der Blick von seinem Balkon über die Elbe ... seine Tochter Amalie, der üppige Engel ... Ach, mein Freund ... über Freiheitsfragen konnte ich mit meinem Onkel Salomon Heine in Hamburg nie disputieren. Deswegen waren die finanziellen Zuwendungen, mit denen er mich schlau besänftigen wollte, für mich immer eine Demütigung. Eigentlich hatte er kein moralisches Recht, mir immer wieder das schnöde Geld zu zahlen. Aber was tun? Ich mußte leben. Und Mathilde, mein Weib in Paris, mein süßes dickes Kind, wollte Austern schlampampern und Kleider aus Samt und Seide tragen. Flanieren ... und Champagner schlürfen ...“
Dann kam es mir vor als ob der Heine in seinem weißen Marmorgrab im Cimetière auf der butte Montmartre eingeschlafen war, und so ging ich meiner Wege.
*
Wenn ich hier heute nicht der Festredner wäre, sondern der Lehrer, und das Ernst-Deutsch-Theater wäre eine pädagogische Anstalt, dann würde ich versuchen, Sie alle in ein spielerische Exerzitie zu locken. Wenigstens ein großes Gedicht sollte jeder Mensch auswendig hersagen können. Sei es zum sich Spreizen im Spiel der Geschlechter und auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten. Oder sei es als poetischer Notproviant, ein Stück Seelenbrot im Knast. Ich würde meinen Schülern die Hausaufgabe aufladen, das Testament des exilierten Dichters Heine, also seine gereimte Lebensbilanz auswendig zu lernen. Das Gedicht „Enfant Perdu“. Es findet sich im Zyklus „Romanzero“, der im Hamburger Verlag Hoffmann & Campe 1851 veröffentlicht wurde. Diese unsterblichen Verse werde ich wohl noch auswendig hersagen können, wenn so vergängliche Worte wie „Bertini-Preis“, „Buddenbrooks“, „Computer“ und „Energiewende“ und „Oevelgönne“ und „Athabaska-Kai“ auf der Festplatte in meinem Schädel längst gelöscht sind. Ich werde Ihnen jetzt zum Schluß das Gedicht aufsagen wie ein braver Schüler in der Abitur-Prüfung bei Schulmeister Magunna.
Im Sinne von Heinrich Heine seid nun Ihr, Jungs und Deerns, geprüft worden: von der Jury gewogen und für schwer genug befunden. Ihr habt immerhin eine Ahnung davon, daß Soldaten in Heinrich Heines Freiheitskrieg der Menschheit keinen Sold kriegen und daß sie gehorsam nur gegenüber den Befehlen des eigenen Gewissens sind. Ihr habt auf Eure Art den Sinn für politische Zivilcourage bewiesen. Dabei mußtet Ihr keine Bäume ausreißen und keine Berge versetzen, weil ihr zum Glück in einer Demokratie lebt. Ihr gehört zu denen, das habt Ihr bewiesen, die unsere Demokratie schätzen, sie ideenreich verteidigen und so am Leben erhalten.
Sollte eines schönen Tages eine totalitäre Diktatur über uns hier hereinbrechen, dann wäret Ihr jedenfalls etwas früher gewarnt und besser gewappnet als solche, die sich niemals tapfer eigemischt haben in den Streit der Welt.
Damit sich ein paar von Euch das Heine-Gedicht bequem in die Tasche stecken können, und anschließend ins Gehirn, habe ich Euch Heines poetische Bilanz abgeschrieben und mit dem Computerprogramm „create booklet“ auf das handlichere Din A5 – Format zweiseitig ausgedruckt.
So´n Spickzettel mit dem schönen Gedicht müßte eigentlich auch meinem Freund, dem Goethe- und Giordano-Fan Michael Magunna gefallen. Der Teufel Mephistopheles liefert dazu die Studentenweisheit im Faust:
Denn was man schwarz auf weiß besitzt,
Kann man getrost nach Hause tragen.
Magunna, Magunna! Du hast uns diesen Bertinipreis eingebrockt!
Du bist schuld an allem! Und wir danken es Dir.
Heinrich Heine (1797 -1856)
Enfant Perdu
Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfte ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.
Ich wachte Tag und Nacht - Ich konnt nicht schlafen,
Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar -
(Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war).
In jenen Nächten hat Langweil' ergriffen
Mich oft, auch Furcht - (nur Narren fürchten nichts) -
Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts.
Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,
Und nahte irgendein verdächt'ger Gauch,
So schoß ich gut und jagt ihm eine warme,
Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.
Mitunter freilich mocht es sich ereignen.
Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut
Zu schießen wußte - ach, ich kann's nicht leugnen -
Die Wunden klaffen - es verströmt mein Blut.
Ein Posten ist vakant! - Die Wunden klaffen -
Der eine fällt, die andern rücken nach -
Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen
Sind nicht gebrochen - nur mein Herze brach.
________________________
Mein Freund lügt nicht
Wolf BIermann: Offener Brief an Liao Yiwu
Veröffentlicht am 28.März 2013 im Feuilleton der WELT
Lieber Liao Yiwu,
die vornehme ZEIT kolportierte dieser Tage allerhand stinkende Neuigkeiten: Deine erschütternden Sittenbilder aus dem Turbo-KZ-Kapitalismus in China seien alles Fälschungen, hysterische Phantasiegeschichten, denn es sei ja gar nicht dermaßen mörderisch für die Millionen Menschen in den chinesischen Gefängnissen und Umerziehungs- und Arbeitslagern. Und daraus folgt natürlich der Vorwurf gegen Dich: Du habest Dir all diese attraktiven Verbrechen gegen die Menschlichkeit nur ausgedacht, damit Du den naiven Gutmenschen im Westen Deine Bücher lukrativ verkaufen kannst. Du habest Dir also mit diesen Lügen den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erschwindelt und den hochangesehenen Geschwister-Scholl-Preis ergaunert. Und es werden sogar etliche Ex-Freunde, die nicht im Exil leben, als Zeugen gegen Dein großes chinesisches Sittenbild in Stellung gebracht.
All das passt grauenhaft gut zu dem, was unser Globalökonom Helmut Schmidt seit eh und je über Rot-China verbreitet: das totalitäre Schlachtfest auf dem Platz des Himmlischen Friedens sei gar kein Massaker gewesen, die Soldaten der Chinesischen Volksarmee hätten sich an diesem 3. und 4. Juni 1989 mit ihren Panzern nur gegen das protestierende Studentenpack in Peking verteidigt.
Immer wieder verklärt der Welterklärer Helmut Schmidt uns die politische Barbarei in fremden Ländern als völkerrechtliches Anderssein, als historisch gewachsene Eigenkultur. Er ist offenbar wirklich der Meinung, daß Demokratie kein Exportartikel sein dürfe und daß die universalen Menschenrechte keineswegs universal sind.
Als sympathischen Kontrapunkt setzt er in jeder Talkshow sein egoistisches Menschenrecht auf eine Zigarette durch. Aber dann bläst er mit dem Rauch solchen Wortequalm ab: Wir hochmütigen Westmenschen sollten die Chinesen gefälligst „nach ihrer eigenen Fasson glücklich werden“ lassen. Wie glücklich sie sind, zeigen Deine Bücher, Yiwu. Diese Chinesen erleiden allenfalls ihre eigene Fasson des Unglücks in einer blühenden Diktatur.
Dabei bin auch ich immer wieder mal entzückt von der hanseatischen Schroffheit des Helmut Schmidt, er ist unter all den Pudding-Politikern ein ehrlicher Knochen. Also grübele ich über seine Motive. Diese Nazi-Kriegs-Generation hat es auch nicht leicht. Grade wenn es aufrichtige Zeitgenossen von Adolf Hitler sind, wie etwa auch Friedrich von Weizsäcker, die also entschlossen die Lehren aus den Verbrechen der Nazizeit gezogen haben, dann quält die Ehrlichsten unter ihnen ihre mehr oder weniger schuldarme Schuld. Ich sage das nicht von oben herab, denn ich kenne diesen Schmerz ja auch - allerdings aus meiner Perspektive des kommunistischen Renegaten. In meinem Rippenkäfig sitzt logischerweise ein kleiner Stalin seine lebenslängliche Strafe ab und tut mir weh. Und – so stelle ich es mir vor - sitzt wahrscheinlich ein verurteilter Hitler im Rippenkäfig des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers Schmidt.
Mich nervt und verwirrt es, daß bei Helmut Schmidt nicht alle Alarmlocken schrillen angesichts dieser modernen Diktatur in China.
Hypertrophe Armee, hypertrophe Umweltvernichtung, hypertrophe Geldreserven, ein neuer Imperialismus in einer wackligen Welt.
Lieber Liao Yiwu, es ergab sich vor etwa 15 Jahren die Gelegenheit zu einem längeren Gespräch mit unserem Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er hatte mich eingeladen in sein Büro am Speersort, als Herausgeber der ZEIT, also hier in Hamburg. Wir redeten über die Mühen der Wiedervereinigung. Ich stimmte ihm zu, ich bewunderte seinen Scharfsinn, ich widersprach gelegentlich, ich überdachte meine Meinung beim Reden, wie in jedem lebendigen Gespräch. Aber als ich ihm gegenüber darüber klagte, daß die Chinesen eine Chimäre kreiert haben, also zwei einander eigentlich ausschießende Elemente zu einer neuen funktionierenden Symbiose zusammenbringen: das Element der totalitären Diktatur und den wildesten Raubtier-Kapitalismus, da ärgerte ihn mein böses Wort „Turbo-KZ-Kapitalismus“.
Er ist offenbar über beide Ohren verliebt in dieses China. Er belehrte mich in seiner knurrigen Art. Als ich aber in aller Bescheidenheit beharrte, obwohl ich kein China-Kenner bin, blaffte der China-Versteher mich an mit einem Hammer- und Sichel-Satz:
„Ernähren Sie mal jeden Tag eineinhalb Milliarden Menschen!!!“
Nun blaffte ich zurück: Die ernähren sich selber! Und das Volk füttert außerdem seine eigenen Unterdrücker! Und die Untertanen produzieren die Ketten, den Stacheldraht, die Kerker und die Panzer, mit denen sie unterdrückt werden! Na ja, Herr Schmidt verstand mein Chinesisch nicht und ich nicht das Seine. Dein Chinesisch aber, lieber Yiwu, verstehe ich sehr gut. Wie kommt das?!
Mein lieber Freund, wenn wir uns wieder in Hamburg treffen, singe ich Dir am Klavier einen ulkigen Schlager vom jungen Brecht vor, die geniale Musik von Kurt Weill. Da haben wir was zu lachen, denn es ist der Havana-Song einer schlechtbezahlten Hure: „Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt // Ach, bedenken Sie, was man für dreißig Dollar kriegt // Zehn paar Strümpfe und sonst nichts ...“
Lieber Yiwu, ich hoffe, wir finden mal wieder die Zeit für einen Abend am Kamin. Du trinkst einen Schnaps, ich einen Wein, und dann lösen wir mal wieder alle Probleme der Welt. Und dann will ich Dich fragen: Hat der schreckliche Schmidt vielleicht doch – womöglich im größeren historischen Zusammenhang, recht, etwa weil dieser globale Koloß China in nur einem Menschenleben mehrere Epochen und Jahrhunderte überspringen muß? Und dann wiederum die Gegenfrage: muß China es eigentlich? Sind wir eurozentristisch verblendet?
Weltweit floriert der Menschen-Organhandel, Ersatz-Nieren aus den Körpern der zum Tode verurteilten Häftlinge, die wie Frischfleischlieferanten gehalten werden. Chinesische Arbeitssklaven schuften an der globalen Werkbank der freien Welt. Der Hamburger Hafen brummt. Jeden Tag machen Container-Riesen der COSCO (Chinese Ocean Ship Company) bei uns gegenüber am Burchard-Kai fest. Jeder Spielzeugschund, jede Klobürste, jeder Turnschuh, mein Apple-Computer und sogar die riesigen Container-Kräne am Athabaska-Kai : Made in China. Und der Audi-Konzern erwirtschaftet mit seinen starken Autos in China seine größten Umsätze. Wer fährt in Peking die Nobelkisten? Das können doch nicht nur Kader der Partei-Nomenklatura sein! Mercedes floriert dort, BMW macht blendende Geschäfte. Wer zahlt da mit welchem Menschenelend?
Lieber Freund, abgesehen von all dem wollte ich Dir im Affekt der Empörung - und auch öffentlich - einen Kuß in die Seele geben.
Laß Du dich nicht von der Medienmeute und nicht von den „qualifizierten Widersprechern“ des chinesischen Geheimdienstes kirre machen! Ich weiß, daß Du das neueste Rufmord-Theater selber durchschaust. Neid, Rache, Geltungsgier, Judaslohn.
Ich will Dich vergewissern, daß wir hier in unserem gepflegten Schrebergarten, wo jedes Radieschen nummeriert an seinem Platz steht, wohl wissen, daß solche Verleumdungen gegen Dich aus dem chinesischen Propaganda-Apparat nichts sind als Lügen. Ich kenne solche systematischen Verleumdungskampagnen seit 50 Jahren aus eigener Erfahrung.
Lieber Yiwu, man sagt auf Deutsch: Wir kennen das alte Liedchen! Wir haben immerhin die Erfahrungen aus zwei totalitären Diktaturen. Und Du weißt ja aus unseren bislang drei gemeinsamen Konzerten in Hamburg, Berlin und Köln: auch ich kann über die Zersetzungs-Kampagnen gegen Andersdenkende und vom Rufmord gegen tapfere Widersprecher mehr als hundert Lieder singen, deutsche.
_________________
Glanz und Elend der Demokratie
Vortrag am 15. September 2011, Wien, im Parlament
Beichten will ich Ihnen, warum ich frommes Kind – konfirmiert in der Kirche des Kommunismus - die Demokratie in meiner Jugend verkannte und verachtete. Berichten will ich Ihnen, wie ich dann als junger Mann in der DDR das viel zitierte Bonmot von Winston Churchill über das Dilemma der Demokratie immerhin schon halb verstand.
Erst in den lehrreichen Jahren nach meiner Ausbürgerung 1976, erst im Westen, erst seitdem der tapfere Renegat Manés Sperber mir dann in Paris den faulen kommunistischen Zahn gezogen hatte, begriff ich den Glanz, aber auch das Elend der Demokratie schon etwas besser.
„Demokratie ist eine schreckliche, eine miserable Staatsform, aber von allen die es in der Welt gibt, die allerbeste.“
Dieses vielleicht berühmteste Wort des Winston Churchill über die Demokratie lautet, wie es überliefert ist aus einer Rede vor dem House of Commons am 11. November 1947, korrekt als komplettes Zitat:
Many forms of government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.
Auf Deutsch heißt dieses haltbare Wort aus Churchills Rede vor dem Unterhaus in London:
Viele Regierungsformen sind ausprobiert worden und werden noch ausprobiert in diesem Jammertal. Niemand tut so, als wäre die Demokratie perfekt oder der Weisheit letzter Schluss. Ja, es ist sogar gesagt worden, dass die Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen ist, mit Ausnahme all der anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.
Sie werden wissen: Ich wurde mitten in der Nazizeit in einem kommunistischen Nest der Stadt Hamburg ausgebrütet. Und also lernte ich von meiner Mutter, daß Demokratie, wie man in Wien sagen würde, ein Schmarren ist. Wenn nämlich das griechische Wort Demokratie wortwörtlich ins Deutsche übersetzt „Volksherrschaft“ bedeutet, na dann heißt das in der Kommunistensprache richtig mißdeutet: Die Herrschaft des Volkes über seine Unterdrücker und Ausbeute. Demokratie ist also Diktatur: die Diktatur des Proletariats.
Shakespeare liefert den Beweis: Es gibt in jeder starken Tragödie immer auch was zum Lachen: Als der junge Marx 1843 Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung war, hing an seiner Bürotür ein nur halb witzig gemeinter Spruch von ihm selbst, den mancher Bürokrat heute noch gern - und leider ohne Augenzwinkern in Gebrauch nehmen würde:
Ab hier ist Schluß mit der Demokratie!
Marx war ein genialer Denker, groß auch im Irrtum und kleinkariert als Privatmensch. Immerhin wissen wir es von ihm selbst: Marx war gewiß kein Marxist. Aber wir nachgeborenen Marxisten und Murxisten hatten damals immer eine süffisante Haltung zur Demokratie. Wir verachteten sie als ideologische Propagandalüge der Bourgeoisie zur Verschleierung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Als Chruschtschow 1956 seine Geheimrede in Moskau über die Verbrechen der Stalin-Ära hielt, war das eine Art stalinistischer Staatsstreich gegen die Stalinisten in der Parteiführung der Sowjetunion. Nun begann im ganzen Ostblock die sogenannte Liberalisierung, also ein Aufbruch in die Demokratie. Auch für mich und andere linke Rebellen wandelte sich das Wort Demokratie nun in ein positives und auch brauchbares Schlagwort, denn wir konnten damit unsere stalinistischen Partei-Funktionäre in der DDR attackieren.
Wir durchschauten ja immer deutlicher, daß die stalinistische Doktrin von der Diktatur des Proletariats im Grunde nichts anderes war, als die konterrevolutionäre Rechtfertigung einer Diktatur der Parteibonzen gegen das Proletariat, also gegen das partei-eigene Volk.
Und als im Frühjahr 1968 der neugewählte 1. Sekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Alexander Dubček, mit seinen mutigen Genossen im Prager Parteiapparat den Prager Frühling wagte, war das eine Art demokratischer Putsch. Nun wollten auch wir, die staatlich anerkannten Staatsfeinde in der DDR – denken Sie an meinen engsten Freund, den alten Kommunisten Robert Havemann - Demokratie und Kommunismus miteinander verkuppeln. Eine welthistorische Liebesheirat wurde gestiftet: „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Was aus dieser Ehe unmittelbar nach der Hochzeit wurde, wissen Sie.
Damals begegnete mir das berühmte Churchill-Wort über die Demokratie erstmal in der vulgär verkürzten Form. Und ich dachte: Was ´n gewiefter Witzeerzähler: Erstmal lockt Churchill den Zuhörer in die Sottise, daß Demokratie schrecklich sei , damit dann die positive Pointe richtig knallt. Also nahm ich den ersten Teil des Churchill-Zitats nur als raffiniert rhetorische Floskel. Und den zweiten Teil der Aussage: Die Demokratie sei gemessen an allen anderen Formen des Zusammenlebens die allerbeste, nahm ich als ein Lob der Demokratie ohne Wenn und Aber.
Erst viel später las ich ein Buch, das mir in der DDR leider nicht in die Finger geraten war: Die geniale Monographie über den genialen Churchill, geschrieben vom genialen Sebastian Haffner, der mir ein Licht aufsteckte. Nun erst begriff ich, daß der erste Teil des berühmten Zitats von Churchill gar nicht witzig gemeint war, sondern todernst: Sir Winston Churchill verachtete die Demokratie von Herzen, er fand sie zum Kotzen. Das behauptet Haffner über einen Helden der Weltgeschichte, der aber doch wie kein Anderer die Demokratie und tapfer verteidigt hatte. Sir Winston entstammte einer alten englischen Adelsfamilie. Sein Hochmut gegen die Demokratie war also echt vererbt. Aber es war eben ein nobler britischer Hochmut gegen das Volk – und der muß traditionell demokratisch sein.
Churchill hatte als Feldherr 1945 seine Schuldigkeit getan, der Krieg gegen Hitler-Deutschland war gewonnen. Aber der gefeierte Sieger wurde vom englischen Volk im Handumdrehn demokratisch gefeuert. Sogar noch während seiner heiklen Verhandlungen mit Stalin und den Alliierten in Potsdam über die Nachkriegsordnung wurde Churchill bei den Wahlen in London schnöde abgewählt. Was für ein dumpfer Undank! Und schlimmer: Was für ein dumpfer Fehler! Oh, Sancta Simplicitas der Wähler!
Diese Blindheiten tun weh! Aber die schlechteste Demokratie ist immer noch besser als die beste Diktatur. Die geheimen freien Wahlen sind und bleiben der Glanz des demokratischen Staates. Es ist und bleibt der Ruhm und die Ehre der Demokratie, daß ein Volk sich korrigieren kann, daß es seine Führer frei abwählen darf, daß es sie also loswerden kann, ohne sie totschlagen zu müssen.
Sir Winston Churchill hat diese höllische Achterbahn auf dem demokratischen Jahrmarkt am eigenen Leib schmerzlich erfahren: Er lebte nach seiner Abwahl sechs Jahre im Zenit seines Weltruhmes im Abseits. Und noch verrückter: 1951, bei der nächsten Wahl, siegte er dann doch wieder, wenn auch nur knapp, über Labour und kam so abermals an die Regierung. Wie engels-geduldig muß ein Demokrat da sein, wie bescheiden in allem Ehrgeiz!
Allein dieser Fall zeigt uns die Mühsal, das Elend der Demokratie: Volkes Stimme ist eben nicht Gottes Stimme. Sowohl die Wähler wie auch die Gewählten können leicht aneinander und gegeneinander die Geduld verlieren.
Der griechische Philosoph Plato kannte das Problem offenbar schon in seiner antiken Sklavenhalter-Demokratie.
Er klagte:
„Wohlan, mein Freund, wie steht es mit der Diktatur? Ist es nicht so, dass sich die Demokratie selbst auflöst durch eine gewisse Unersättlichkeit in der Freiheit? Wenn Väter sich daran gewöhnen, ihre Kinder einfach gewähren und laufen zu lassen, wie sie wollen, und sich vor ihren erwachsenen Kindern geradezu fürchten, ein Wort zu reden; oder wenn Söhne schon sein wollen wie der Vater, also ihre Eltern weder scheuen noch sich etwas sagen lassen wollen, um ja recht erwachsen und selbstständig zu erscheinen! Und auch die Lehrer zittern vor ihren Schülern ...
Überhaupt sind wir schon so weit, dass sich die Jüngeren den Älteren gleich stellen, ja gegen sie auftreten in Wort und Tat, die Alten aber setzen sich unter die Jungen und suchen sich ihnen gefällig zu machen, indem sie ihre Albernheiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran teilnehmen, damit sie ja nicht den Anschein erwecken, als seien sie Spielverderber oder auf Autorität versessen. Auf diese Weise werden die Seele und die Widerstandskraft aller Jungen allmählich mürbe. Sie werden aufsässig und können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man ein klein wenig Unterordnung von ihnen verlangt. Am Ende verachten sie auch die Gesetze, weil sie niemand und nichts mehr als Herr über sich anerkennen wollen. Und das ist der schöne, jugendfrohe Anfang der Tyrannei!“
Platon (427 bis 347 v. Chr.)
Fast zweieinhalb Jahrtausende alt! Und klingt wie heute geschrieben. Es klingt, als wär´s ein Stück von mir, will sagen, als wäre es ein kluger Seufzer von Dir!
*
Demokratien haben einen fundamentalen Vorteil: sie befördern offenbar den fruchtbaren Streit innerhalb der Völker - und sie verhindern den fruchtlosen Krieg zwischen den Völkern.
Es wüteten in der ganzen Weltgeschichte große und kleine Verdrängungskriege, auch Religionskriege und Wirtschaftskriege um Macht und Ressourcen, aber noch niemals hat es in der Neuzeit einen Krieg gegeben zwischen zwei Demokratien! Als ich diese Behauptung zum ersten mal hörte, widersprach ich automatisch wie Luft holen. Aber dann holte ich tief Luft und dachte tiefer nach ... und fand kein einziges Gegenbeispiel.
Liegt da womöglich der Schlüssel versteckt für einen Frieden im Nahen Osten?
Die Ägypter müssen es schaffen, ihren kranken Staat zu demokratisieren. Das beste humane Heilmittel dafür ist – anders kann ich es mir gar nicht denken - die moralische Substanz des Islam. Das Prinzip des Friedens findet sich im Koran so gut, wie im Judentum und im Christentum.
Die neuesten Nachrichten aus Kairo zeigen es aber brutal: Die Kriege werden in dieser Region weiterbrennen und glühen und glimmen und schmoren und explodieren. Wenn ein fanatischer Mob sich aus der Tyrannei eines Mubarak befreit, um gleich mal die Botschaft Israels, der einzigen Demokratie im Nahen Osten, zu brandschatzen, dann graut mir vor dieser blutrünstigen Demokratisierung. Da gilt dann auch für die nächsten Ewigkeiten die fatale Grundwahrheit der Historiker: Es gibt tief eingefressene Konflikte, für die kann es keine Lösung geben, die haben eben nur eine Geschichte.
Immanuel Kant hat in seiner Altersschrift „Zum ewigen Frieden“ uns darüber aufgeklärt, daß der Frieden kein natürlicher Zustand des Menschengeschlechts ist. Nur durch vernünftige Gesetze und gerechte Verträge kann ein Friede gestiftet werden. Kant schrieb gegen die Tyrannei der Despoten seiner Zeit und forderte Gerechtigkeit und Recht und Gesetze. Aber kein Menschenrecht und kein Völkerrecht, kein Gesetz kann ohne Machtmittel durchgesetzt und verteidigt werden. Recht ist eben eine Frucht am Baume der Kultur und ist kein Zufallsgeschenk der Wildnis. Und zu dieser Kultur gehört notwendig auch Gewalt, die eine Not wendet.
Unser lebenskluger Finanzfachmann Horst Köhler war nach meiner Meinung als Bundespräsident für die Deutschen ein Glücksfall. Und sein Rücktritt nach einem niederträchtigen Tritt vom totalitären Grünen Trittin war gar kein Glück für Deutschland. Köhler hatte Recht, als er in einem Nebensatz einem Reporter die peinliche Binsenwahrheit ins Mikrophon plapperte, daß eine Demokratie sich mit Waffengewalt schützen muß. Zur Verteidigung gehört eben auch die militärische Verteidigung legitimer wirtschaftlicher Interessen, etwa der Schutz internationaler Handelswege gegen professionell gerüstete Piraten am Horn von Afrika, die auch für Deutschland, das in hohem Maße vom Welthandel lebt, ja überlebenswichtig sind. Die Demokratie muß fähig und bereit sein, einen Verteidigungskrieg zu führen.
Dabei wissen wir alle: jeder gerechte Krieg ist automatisch auch ein Unrecht, allein schon deshalb, weil immer auch Unschuldige getroffen werden. Kugeln sind weder demokratisch noch diktatorisch, sie sind tödlich. Und die Tränen der Mütter auf beiden Seiten sind salzig, auch die Tränen der Mütter von paradiessüchtigen islamistischen Selbstmordmördern im Terrorkrieg.
Wir Deutschen können heute über dieses Dilemma übrigens nur in Ruhe nachdenken und öffentlich streiten, weil Millionen Soldaten der Anti-Hitler-Koalition kämpften und starben und siegten.
Die europäische Union ist ein demokratisches Lebenselixier grade auch für die Deutschen. Deshalb finde ich es richtig, dass Angela Merkel dem Heimatland der Demokratie Griechenland immer noch großzügig und stur die europäische Stange hält und zugleich, wie eine sparsame und kluge Hausmutter, das große Portemonnaie festhält, solange nicht sicher ist, daß unsere deutschen Steuermilliarden eine Hilfe zur griechischen Selbsthilfe sein werden.
Die Eurokrise ist eine Staatsschuldenkrise. Nicht nur die griechischen, auch die deutschen Politiker leben auf Pump, damit sie ihr Wahlvolk bestechen können mit sozialen Wohltaten. Das Elend der Demokratie liegt darin, daß alle Politiker, die etwas Gutes nicht nur für sich und ihre Partei, sondern auch für ihren Staat oder sogar für die Menschheit befördern wollen, Mehrheiten nur gewinnen können, wenn sie immer auch vom stumpfsinnigsten Pack gewählt werden.
Die dreigliedrige Gewaltenteilung in Legislative, Rechtsprechung und Regierung war ein historischer Fortschritt auf dem Weg in die demokratische Freiheit, ein Weg, den allerdings die meisten Staaten in der UNO, die bei Abstimmungen in New York die Mehrheit bilden, noch vor sich haben.
In unserer Epoche kam nun als vierte Säule des Gemeinwesens die wachsende Macht der Massenmedien hinzu. Die Presse – und noch stärker das Fernsehn. Und eine Art fünftes Bein: die digitale Naturgewalt des Internet. Sogar im totalitären China erobert die Twitter- und Facebook- Generation sich immer mehr Freiheiten, kleine virtuelle Schritte auf dem Weg in die reale Freiheit.
Auch die Medien machen das Wetter.
Die Wahltermine hängen in der Demokratie wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der politischen Macher. Der Einfluß der Medien ist wahlentscheidend.
Die Politprofis im Parlament können ja bei jedem praktischen Schritt, bei jedem öffentlichen Wort nur einmal überlegen: Ist dieser Schritt richtig so? Aber zehnmal müssen auch die Großmütigsten kleinmütig spekulieren: bringt es Wählerstimmen oder kostet es Prozente bei der nächsten Wahl. Die Verführung, den Dumpfbacken nach dem Munde zu reden, ist riesig. Es geht um Ansehen, Karriere und Gestaltungs-Macht. Und so passiert es eben, daß die Stimmenfänger – Augen zu! und durch!! - in die Schuldenfalle tappen: Sie verteilen das, was sie nicht haben, natürlich auf Pump.
Nicht nur die Italiener, Griechen und Spanier und Portugiesen und US-Amerikaner leben über ihre Verhältnisse, sondern auch wir überordentlichen Deutschen. In dieser Hinsicht sind eben nicht die parasitären Spekulanten schuld an der Schuldenkrise, sondern die populistischen Politiker, die immer mehr Schulden machen, um gewählt zu werden.
Ich bin heilfroh, daß ich in dieser Zerreißprobe der Politiker nicht leben muß: Sie müssen und sollen auf Volkes Stimme hören – und trotzdem ihrem Wissen und Gewissen folgen.
Und - und – und!
Ich bin mir gar nicht sicher, ob etwa der panische, will sagen: der seit dem Unfall in Fukushima ja-panische Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie nicht ein folgenschwerer und grotesker Fehler ist. Sind wir am Anfang der Atomkraft-Epoche oder am Ende? Auch die klügsten Wähler in Deutschland sind nicht grade gut ausgerüstet für eine hinreichende Urteilskraft in dieser komplexen Menschheits-frage. Und die Grünen surfen fröhlich auf der apokalyptischen Angstwelle.
Auf meine naturwissenschaftliche Bildung wurde einige Mühe verwandt. Ich habe Mathematik studiert und sogar mit „Sehr gut“ an der Humboldt-Universität in Berlin absolviert. Mein Freund Robert Havemann, der bedeutende Professor für Physikalische Chemie hat mir in den 12 Jahren, als wir in Ostberlin beide total verboten waren und deshalb schön viel Zeit hatten, den Energieerhaltungssatz der Thermodynamik beigebracht und den Unterschied von Kernspaltung und Kernfusion. Ich könnte Ihnen ganz gut die Wirkungsweise eines Absorber-Kühlschranks und eines Kompressorkühl-schranks erklären – Aber dennoch bin ich ein Laie!!
Wie sollen lebenserfahrene und mündige Bürger, die sich nie im Leben mit Physik beschäftigt haben, über Chancen und Gefahren der Atomkraftnutzung entscheiden. Ich kann es nicht.
Lassen wir das lieber, es macht nur böses Blut. Besonders wütend streitet man, wenn man zu wenig Ahnung hat. Lassen Sie mich lieber über Dinge reden, die ich etwas tiefer verstehe, lassen Sie mich am Schluß an das Wort von Plato anknüpfen, wenn er sagt, daß die verwöhnten Kinder der Demokratie in der Gefahr sind, die Demokratie gering zu achten und der Freiheit am Ende sogar überdrüssig werden und also reif sind für den Absturz in die Tyrannei.
In dieser Gefahr sind wir, die gebrannten Kinder des Kommunismus, die wir aus den finsteren Zeiten der zwei Diktaturen uns herauskämpften, wohl kaum. Im Gegenteil. Solche wie ich haben einen anderen Knall. Wir Diktaturgeschädigten sehen - umgekehrt - die endlich errungene Demokratie manchmal all zu romantisch naiv im verklärten, in allzu mildem Lichte.
Wie finster aber auch die schönste Demokratie sein kann, wie gefährlich auch die Freiheit, das will ich eigentlich gar nicht wahr haben, und das irritiert und ärgert mich.
Freiheit ist so ein Zauberwort. Dabei sollte ich doch aus der Erfahrung im Streit der Welt wissen: Freiheiten sind nicht das Gleiche wie Freiheit. Im Plural: Freiheiten werden von Machthabern gewährt oder eben nicht gewährt. Aber im Singular Freiheit, also DIE FREIHEIT - tja, die gibt es eben nur für die Einzelnen wie für die Völker, die den Mut haben, sich die Freiheit zu nehmen.
Die Fernsehapparate liefern tagtäglich und wohlfeil das Elend aus aller Welt in alle Welt. Wir reiben uns die Augen und sehen: Auch die beste aller möglichen Welten, also die Demokratie, ist ein groteskes Chaos. Auch die Wege der Freiheit sind steinig, sind dunkel und gefährlich.
Warum ich in diesem schönen Saal des Wiener Parlaments mitten in der funktionierenden Demokratie Österreichs so düster rede? Weil die Franzosen ein schönes Sprichwort haben, das auch für die Frau in mir gilt: „Ein gewarnter Mann ist doppelt stark.“
(Ende der aufgeschriebenen Rede)
*
Die Präsidentin des Parlaments in Österreich, ist schuld daran, daß ich hier heute rede. Sie hat mich nämlich auch dazu verführt, mit ganz jungen Leuten in Ruhe zu reden. Eines der Lieblingskinder von Frau Barbara Prammer ist offenbar die Demokratie-Werkstatt, wo Schüler und Lehrlinge aus Österreich die Spielregeln der Demokratie mit spielerischem Ernst trainieren. Ich war grad eben hier nebenan mit diesen hochmotivierten und gut vorbereiteten Jungen und Mädchen, alle etwa 13 Jahre alt, zusammen und habe mich von ihnen ausfragen lassen als einer, der beide deutschen Diktaturen erlebt hat. Denen kam es womöglich vor, als ob sie mit einem Kämpfer aus den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert reden.
Es gefällt mir, daß auch mein eigener Sohn Lukas hier ist, er sitzt irgendwo da hinten im Saal mit ein paar Freunden und kontrolliert, ob sein Vater was Brauchbares liefert.
Lukas Biermann lebt seit einem Jahr hier in Wien, weil er bei einem der drei besten Schumacher, sie arbeiten in London, Wien und Budapest, eine ordentliche Lehre macht. Es begeistert mich, wie begeistert er ist von diesem noblen Beruf.
Wenn er in zwei Jahren als Schumacher-Geselle nach Hamburg zurück kommen wird und mich – werweiß – fragen wird, welche Partei er bei den nächsten Bundestagswahlen wählen soll, muß ich ihm die Wahrheit sagen: Ich weiß es nicht. Raten könnte ich ihm nur, daß er auf keinen Fall die Erben der ersten und auch nicht die Erben der zweiten Diktatur in Deutschland wählen darf. Aber auch das werde ich nicht tun, denn diesen Rat braucht dieser kluge Knabe zum Glück nicht.
*
Meine Gitarre habe ich heute nicht mitgebracht, es paßte mir nicht zu solch einer Rede am Rednerpult im Parlament. Aber ich möchte Ihnen zum Schluß doch - mit bloßen Händen – ein Lied vorsingen, das ich damals in Ostberlin schrieb, nach dem Einmarsch der fünf Warschauer-Pakt-Armeen in die Tschechoslowakei.
Es paßt zum uralten Thema Diktatur und Demokratie.
Wir Oppositionellen in der DDR hatten damals natürlich die Hoffnung, daß dem Prager Frühling auch ein Berliner Frühling folgt. Nun aber waren wir tief niedergeschlagen. Wir erlebten die Wahrheit eines Satzes, den Brecht mal schrieb in seinen Anmerkungen zum Stück „Leben des Galilei“: „Den übertriebenen Hoffnungen folgt leicht die übertriebene Hoffnungslosigkeit“ - Und gegen diese Demoralisierung mußten wir in den finsteren Zeiten nach dem 21. August 1968 ankämpfen. Also sang ich mir und meinen Freunden zur Ermutigung ein Lied, das ich in einer Woche in Dortmund, beim Internationalen Chortreffen mit meinem Freund Gunnar Eriksson vom berühmten Göteborger Kammerchor einüben werde:
Lied von den bleibenden Werten
1
Die großen Lügner, und was - na, was
Wird bleiben von denen?
Von denen wird bleiben – was - was - was - was
- dass wir ihnen geglaubt haben
Die großen Heuchler, und was - na, was
Wird bleiben von denen?
Von denen wird bleiben
- dass wir sie endlich durchschaut haben
2
Die großen Führer, und was - na, was
Wird bleiben von denen?
Von denen wird bleiben – was - was - was - was
- dass sie einfach gestürzt wurden
Und ihre Ewigen großen Zeiten – na was
Wird bleiben von denen?
Von denen wird bleiben
- dass sie erheblich gekürzt wurden
3
Sie stopfen der Wahrheit das Maul mit Brot
Und was wird bleiben vom Brot?
Bleiben wird davon - na, was? -
- dass es gegessen wurde
Und dies zersungene Lied - na, was
Wird bleiben vom Lied?
Ewig bleiben wird vom Lied
- dass es vergessen wurde
_________________________________
Rede bei der Vorstellung des Buches „Der aufrechte Gang„
am 26. März 2009 im Schloss Bellevue
Lieber alter Freund und Pfarrer Eppelmann,
lieberer neuer Freund und Präsident,
Sie haben mich hier in diese Köhlerhütte gelockt, will sagen: in das schöne Schloss Bellevue eingeladen, damit ich 15 Minuten über das Thema Freiheit rede. Ein Thema, über das wir Menschen schon nachdenken, reden und quasseln und singen und schreiben und streiten und auch schweigen, seit wir von den Bäumen runter in die Höhlen gegangen sind, in die Hütten, in die Paläste, in die Häuser und in die großen Städte.
Freiheit, Freiheit? Freiheit! und Freiheit – es gibt kein Wort, das so tief geht und das so flach sein kann wie Freiheit, so klagend und so fordernd, so wahrhaftig und so verlogen, so tapfer provokant und so spießig gemütlich. Heinrich Heine spottete in einem Gedicht an einen politischen Dichter, er meinte Hoffmann von Fallersleben, von dem er nicht chronisch entzückt war:
Der Knecht singt gern ein Freiheitslied
Des Abends in der Schenke:
Das stärket die Verdauungskraft
Und würzet die Getränke.
Es gibt wirklich kein anderes Wort, das so wie das Wort Freiheit heilig ernst ist und dermaßen verhurt. Was wir Freiheit nennen, hat eine lange Geschichte. In der Antike, das wissen Sie wohl, war die Freiheit keineswegs ein Menschenrecht, sondern ein Privileg, ein Vorrecht. Und was ich daran so interessant finde: Es gibt in der ganzen klassischen Literatur der Antike weder bei Homer noch Sophokles, nicht mal bei dem Spötter Aristophanes ein einziges Beispiel dafür, dass jemand sich über die Sklaverei empört. Kein kritisches Wort – nicht, weil das alles Feiglinge waren, sondern weil sie es als natürlich empfanden, dass es Sklaven gibt und Nichtsklaven. Und wenn einer rebellierte, dann eigentlich nur, damit er selber kein Sklave mehr ist und selber Sklavenhalter werden kann.
Es sind die Juden gewesen, die vielleicht zum ersten Mal aus dieser Beschränktheit rauskamen; sie feiern jedes Jahr das Passah-Fest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten durchs Rote Meer. Die Flucht aus der Sklaverei in die Freiheit: Ich erinnere mich genau. Das war schon ein rigoroserer Weg in eine Freiheit, nicht nur für Untere oder Obere, reiche, arme Männer und Frauen, sondern für Menschen – für die Menschheitsentwicklung ein großer Schritt.
Im christlichen Mittelalter geriet die Freiheit in ein schlechtes, schwaches Licht. Die Christen wollten die Freiheit eigentlich nur nach dem Tode im Paradies, wo dann alles gut ist. Aber der geniale Judenfresser Luther schrieb seine Schrift von der Freiheit des Christenmenschen, wo er immerhin gegen den Stachel löckte und verlangte, schon auf Erden, zu Lebenszeiten frei zu sein - z.B. dass er mit einer Frau leben kann, aber nicht nur das.
Sie wissen, es kam dann die Aufklärung, die den Moslems noch bevorsteht. Die hatten noch keinen Voltaire, keinen Moses Mendelssohn. Sie kennen alle den berühmten Satz von Voltaire: "Ich bin nicht Eurer Meinung, aber ich werde darum kämpfen, dass Ihr sie vertreten könnt." Sie haben womöglich Kant gelesen, der auf die Idee kam, dass die Freiheit ohne Vernunft ein tierisches Gewürge ist, nichts wert. Es kam der Hegel, den wir hauptsächlich kennen, weil Engels ihn zitiert hat mit dem schönen Satz, dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit ist - worauf solche gebrannten Kinder wie wir natürlich sofort sagen: Wer bestimmt hier, was notwendig ist? Und welche Not soll da von wem gewendet werden? Zumal wir so "Notwender" erlebt haben, die uns in die größten Nöte gebracht haben. Deswegen sitzen wir heute hier.
Inzwischen habe ich lernen müssen, dass man vor keinem soviel Angst haben muss wie vor jemandem, der die Menschheit befreien will und retten will. Böse gesprochen: Wer den Kommunismus errichten will, also eine klassenlose Gesellschaft ohne antagonistische Widersprüche, wie wir es im Fach "Maxi-mus Leni-mus" gelernt haben, in klares Deutsch übersetzt: ein Narrenparadies, wo alle Menschen Brüder sind, wie Schiller pathetisch tönt, wo es keine Ausbeutung, keine Unterdrückung und keine Heuchelei gibt und, bösartig formuliert, in Anlehnung an die Endlösung der Judenfrage, die uns geläufig ist: die Endlösung der sozialen Frage... Unter uns gesagt, wir können ja hier offen reden: Diese Hölle wird hoffentlich niemals ausbrechen.
Und das ist der Grund, warum ich, der geboren wurde in die kommunistische Religion, nun kein Kommunist mehr sein kann. Nicht weil ich mich vom Freiheitskrieg der Menschheit verabschiedet habe oder ein gekaufter Lump geworden bin, sondern weil ich kein Menschenfeind sein kann. Weil ich das Erbe meines Vaters, in dessen Tradition ich erzogen wurde von meiner Mutter, ernst nehmen muss; Kommunist, Jude, Kämpfer gegen die Nazis, aber er war niemals ein Bonze irgendeiner Partei, die die Menschheit beglücken will mit der Endlösung der sozialen Frage. Wenn mein Vater überlebt hätte und in der DDR gelebt hätte, hätten die Stalinisten ihn noch zehnmal tot geschlagen, weil er ein Mensch war und tapfer. Und weil das alles so in mein kleines Menschenleben reingeht, diese großen geschichtlichen Zusammenhänge, kann ich auch nicht gelassen darüber reden. Das rüttelt an meinem Herzen.
Immerhin verdanken wir dem Marx, dass er auf die gute Idee kam, dass die Freiheit des Menschen, sich zu entscheiden, sein freier Wille, so oder so zu machen im Streit der Welt, in einem unglaublich brutalen Maße abhängt von der sozialen Schicht, der sozialen Lage, in die er hineingeboren wird. Die Teilung der Menschheit in Reiche und Arme ist ein brutaler Gleichmacher, fördert überhaupt nicht die Entwicklung der Individuen.
Sie alle kennen das berühmte Wort von Rosa Luxemburg, es wurde längst zu Tode zitiert. Ich habe es relativ jungfräulich ins Offene gebracht beim Kölner Konzert, da war das noch eine Sensation: Freiheit, das ist die Freiheit der Andersdenkenden.
Rosa Luxemburg schrieb das 1917 im Gefängnis über die russische Revolution. Und es war eine Kritik an den Bolschewiki, an Lenin, Trotzki, Bucharin. Sie pochte darauf, dass in der revolutionären Bewegung Freiheit herrschen muss. Nachdem sie tot war, ermordet am 15. Januar 1919 - hier schwamm sie im Landwehrkanal - 1922 wurde diese Schrift veröffentlicht, aber im Grunde nie gelesen. In der DDR übrigens veröffentlicht, aber auch nie gelesen. Und als die jungen Leute in den letzten Tagen der DDR mit dieser Losung sich beteiligten - Sie kennen die Bilder mit der aufreizenden Losung von Rosa Luxemburg - wurden sie von der Stasi verprügelt, die Transparente wurden ihnen weggerissen und sie wurden eingesperrt, oder ausgesperrt in den Westen. Und die Erben dieses Packs, das all das verbrochen hat - die PDS, die Linke nennen die sich, die neue Linke, die nach meiner Meinung weder neu noch links ist - schmücken sich jetzt mit der Rosa Luxemburg. Aber (das muss unter uns bleiben) leider nicht ganz zu Unrecht. Deswegen kann ich den Mund hier nicht zu voll nehmen, wenn ich mich darüber beschwere, dass Rosa Luxemburg missbraucht wird. Denn Rosa Luxemburg war sehr kompliziert in der Freiheitsfrage.
Sie war nämlich für die Freiheit, aber nur Freiheit für die, die ihrer Meinung sind. Im Grunde war sie genauso dogmatisch wie die anderen, nur anders dogmatisch. Sie war auch der Meinung, dass man dem Gegner den Stiefel in den Nacken drücken soll und ihn töten soll; erbarmungslos. Warum? Obwohl sie doch so sanftfühlend war - wir kennen ihre Briefe aus dem Gefängnis, die uns heute noch zu Tränen rühren. Aber wenn es um die Befreiung der Menschheit geht, wie ich schon sagte: die Endlösung der Sozialen Frage, dann gibt es kein Verbrechen, das man nicht begehen darf nach dieser Revolutionsmoral.
Und das ist der Grund, warum wir heute, salopp gesprochen, die Schnauze voll haben, vornehmer ausgedrückt: uns fürchten vor allen Leuten, die uns ein Himmelreich auf Erden versprechen. Die absolute Freiheit. Besten Dank, ich will die nicht haben. Ich will lernen, ohne diesen Kinderglauben auf dieser Erde einigermaßen anständig zu leben, mich wehren gegen Unrecht, tapfer sein, so gut ich kann. Ich schrieb mal ein Lied, wo es heißt: Die Zukunft wird nämlich entschieden im Streit um die Vergangenheit. Und da singe ich über Rosa Luxemburg: "Wer weiß, ob sie gemordet hätte unterm Freiheitsbaum…" Eine gefährliche Zeile, aber es ist - leider - die Wahrheit.
Ich halte Ihnen das vor die Nase, damit Sie deutlich spüren, wie vorsichtig man sein muss mit so einem heiligen Wort wie Freiheit. Aber es ist auch komisch: Wir sind ja nun die Deutschen, und die Deutschen pflegen - das haben Sie sicher auch schon deutlich gemerkt - ein anderes Verhältnis zur Freiheit als die Franzosen oder die Amerikaner. Es gibt ein berühmtes Lied; ich bin sicher, das kennen sogar einige junge Leute, die hier sitzen:
Freiheit, die ich meine,
Die mein Herz erfüllt,
Komm mit deinem Scheine,
Süßes Engelsbild!
Magst du nie dich zeigen
Der bedrängten Welt?
Führest deinen Reigen
Nur am Sternenzelt?
Also nicht hier auf der Erde. Das stammt von Max von Schenkendorf, Dichter der Befreiungskriege gegen Napoleon. Und ich will Ihnen die Augen öffnen für eine delikate Besonderheit. Freiheit, die ich meine, heißt aber nicht "meine", sondern "die ich minne". Da steckt das Wort drin: Freiheit, die ich "liebe": Minnesang, Minnedichtung. Kennt Ihr doch! Und das ist für uns Deutsche hochinteressant. Die Minnedichtung, die Liebesdichtung der Minne im Mittelalter, 10., 11., 12., 13. Jahrhundert. Da war es so, dass der Minnesänger die Dame des Fürsten ansang, anhimmelte. Also, ich müsste dann auf Ihre Frau Luise Liebeslieder singen, aber sehr geschickt sein, dass da nichts wirklich handfest Erotisches reinkommt, weil sonst wird das für mich schwierig. Das heißt, Minnesang bedeutet immer: schwärmen, aber nicht machen. Nicht ran an das Weib. Und das in einem berühmten deutschen Lied über die Freiheit. Freiheit, die ich minne, dass dieses Wort verwendet wird, ist ja ein wunderbares Indiz dafür, dass die Deutschen mit der Freiheit lieber fummeln statt .... f.... faire l’amour.
Wie Sie schon dunkel ahnen, sind die Franzosen in diesem Punkt anders. Die Franzosen sangen in der gleichen Zeit:
Ah! ça ira, ça ira, ça ira!
Les aristocrates à la lanterne! ...
auf Deutsch etwa so:
Ran! Ran! Hängt die Aristokraten auf!
Hängt sie alle an ... die Laterne ran!
Die Tyrannei wird ruiniert,
Und die Freiheit triumphiert!
Aber die Franzosen gehören zu den Menschen, die können auch nur mit Wasser kochen, was die Freiheit betrifft. Weil hier so viele junge Leute von Ihnen angelockt wurden, Herr Köhler, Herr Eppelmann, freut es mich, Ihnen ein Licht aufzustecken zu einer Sache, über die auch ältere Exemplare, auf deren Bildung viel Mühe verwandt wurde, nicht Bescheid wissen. Die Losung, die Sie alle kennen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die in Paris an jeder Hundehütte in Stein gemeißelt ist; die Losung der französischen Revolution kennt jeder. Sollte aber im Hinterkopf wissen: Ursprünglich hieß diese Losung nicht "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", sondern nur "Gleichheit, Freiheit". Zwei Worte. Und der Zeitgenosse Johann Wolfgang von Goethe, der ja ein Weltbürger war und eine weise Übersicht über dieses uralte Problem hatte, hat sich lustig gemacht darüber und hat gesagt: Wer Freiheit und Gleichheit zugleich verspricht, ist ein Lügner oder ein Dilettant – ein Idiot. Das schließt sich ja gegenseitig aus.
Entweder man ist frei oder man ist gleich. Nun kann man noch lange darüber diskutieren, ist mit Gleichheit gemeint, gleiche Gesetze für alle oder gleiche Lebensmöglichkeiten für alle, gleicher Reichtum oder gleiche Armut? Und die Franzosen, auch nicht dumm, kamen dahinter, dass das ein bißchen schwierig ist, das hinzubiegen, und deswegen setzten sie als Flußmittel zwischen diesen beiden Antagonismen das schöne Wort Brüderlichkeit. Das Zauberwort Brüderlichkeit soll diesen unlösbaren Konflikt, der immer wieder neu entsteht, auch in unserer Zeit heute, im Streit um Hartz IV, um Weltwirtschaftskrise, Gleichheit und Freiheit auf den Märkten im sozialen Gefüge der Gesellschaft entschärfen. Und das, finde ich, ist eine geniale Erfindung.
Die Deutschen haben übrigens ein berühmtes Freiheitslied, das kennen Sie alle, da bin ich mir sicher, egal wie alt Sie hier sind:
Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten?
Wenn wir hier eine Singakademie hätten, könnten wir das jetzt alle zusammen singen. Und ich würde Sie gerne reinlocken. Aber ich erspare mir das, ich wollte sagen, ich erspare Ihnen das.
Sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen
mit Pulver und Blei:
Die Gedanken sind frei!
Ich denke, was ich will
und was mich beglücket,
doch alles in der Still’
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!
Und sperrt man mich ein
im finsteren Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke.
Na, reden sie mal mit einem, der im Knast bei der Stasi saß und gequält wurde. Der wird die Strophe nicht so toll finden. Es sind nicht vergebliche Werke. Die Menschen gehen auch kaputt. Und lassen Sie sich nicht davon täuschen, daß immer nur diejenigen das Maul aufreißen, die überlebt haben wie ich. Die gut davon gekommen sind, wie ich, die Glück hatten wie ich. Wenn Sie mich hier sehen, denken Sie immer an all die, die nicht Lieder singen, die nicht berühmt sind, die vergessen sind, wo nur eine Mutter geweint hat oder eine Frau oder ein Kind. Am Ende seines Lebens hat Brecht diese Tragik nach seinem Honeymoon mit dem Kommunismus geahnt. Er schrieb ein kleines Gedicht:
Selbst die Sintflut
Dauerte nicht ewig.
Einmal verrannen
Die schwarzen Gewässer.
Freilich, wie wenige
Dauerten länger!
Wir hier, die wir hier sitzen im verschiedenen Grad der Verstümmelung durch Leiden in diesem Streit, wir sind alle die Glücklichen hier. Da könnte man schlau sagen: "Nein, ihr seid die Unglücklichen, weil ihr noch leben müßt." Aber dies Leid trage ich gerne. Will mir aber dessen bewußt sein, daß ich nur überlebt habe, weil ich ein Glückskind bin.
Ich liebe am meisten von dem Dichter, den wir alle mehr oder weniger lieben und bewundern: Heinrich Heine, ein Gedicht, das er gegen Ende seines Lebens schrieb, als er gerade mit einem Fuß schon in der Matratzengruft in Paris war, krank am Körper, aber hellwach und gesund im Kopf und im Herzen.
Da schrieb er eine Art Bilanz seines Lebens mit dem Titel „Enfant Perdu“. Und in diesem Gedicht kommt das Wort "Freiheitskrieg" vor. Und als ich das las, hat es mich elektrisiert, begeistert und erleichtert. Was soll ich machen, ich darf doch nun gar kein Kommunist mehr sein, weil ich begriffen habe, daß das der Weg in die Hölle ist. Möchte aber doch im Streit der Welt auf Seiten der Menschen stehen und mich wehren, weil ich begriffen habe, daß man gar nicht so sehr kaputt geht an den Schlägen, die man kriegt, sondern hauptsächlich an den Schlägen, die man gegen die Unterdrücker leider nicht austeilt.
Und in diesem Freiheitskrieg befinden wir uns alle, auch jetzt in der Weltwirtschaftskrise - auch eine Etappe im Freiheitskrieg der Menschheit. Ich sehe die Weltwirtschaftskrise als eine Riesenchance, daß wir auf den Weg geprügelt sind, endlich so etwas wie eine Menschheit zu werden auf diesem Dorf, Globus genannt. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir kaputt. Aber das seelische Rüstzeug, um solche Kämpfe zu bestehen, kriegt man wunderbar, wenn man sich das Gedicht von Heinrich Heine reinfrißt. Ja, wenn ich Minister hier wäre in Ihrem Staat, in unserem Staat wollte ich sagen – nein, ich wäre lieber doch Despot, weil in wichtigen Fragen darf es keine Demokratie geben, das muß von oben entschieden werden - das soll abermals unter uns bleiben - dann würde ich bestimmen, daß die Kids in der Schule etwas lernen, was die Lehrer auch noch nicht können. Also, sie sollten auswendig lernen das Gedicht "Enfant Perdu" von Heinrich Heine, wo er 1851 rückblickt auf sein Leben und dort dieses Zauberwort Freiheitskrieg der Menschheit in die Welt setzt.
Wobei Sie wissen sollen, daß es auch Heine war, der als Erster das Modewort Kommunismus von Frankreich nach Deutschland transportiert hat. Alle waren damals Kommunisten, die was taugten. Wer heute noch Kommunist ist, taugt gar nichts. Aber Heine lebte ja nicht davon, daß er gewählt wird vom Pack, er wollte ja geküßt werden von den Musen, auch eine Abhängigkeit, aber besser. Ich möchte, dass Sie das Gedicht auswendig lernen, ist das denn ein zu großer Wunsch? Man muss doch auch was auf dem Konto haben, im Gehirn, meine ich.
Also, das wäre meine Bitte an Sie, die hier zufällig versammelt sind, Sie alle sind ja offenbar ausgesucht nach diesem Prinzip, daß Sie Leute sind, die sich besonders lebendig einmischen in diesen Freiheitskrieg der Menschheit. Also, dann tun Sie sich doch den Gefallen und mir die Freude und lernen Sie, wenn das hier vorbei ist, in Ruhe dieses Gedicht auswendig. Und bringen Sie es ein paar Leuten bei, die sich daran freuen sollen. Ich will nun sehen, ob ich es überhaupt selber kann:
Enfant Perdu
Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfte ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.
Ich wachte Tag und Nacht - Ich konnt' nicht schlafen,
Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar -
(Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war).
In jenen Nächten hat Langweil' ergriffen
Mich oft, auch Furcht - (nur Narren fürchten nichts) -
Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts.
Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,
Und nahte irgendein verdächt'ger Gauch,
So schoß ich gut und jagt' ihm eine warme,
Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.
Mitunter freilich mocht' es sich ereignen,
Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut
Zu schießen wußte - ach, ich kann's nicht leugnen -
Die Wunden klaffen - es verströmt mein Blut.
Ein Posten ist vakant! - Die Wunden klaffen -
Der eine fällt, die andern rücken nach -
Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen
Sind nicht gebrochen - nur mein Herze brach.
Wolfgang Heise - mein DDR-Voltaire
Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde
Humboldt-Universität zu Berlin am 7. November 2008
Dieser Tage beriet ich mich, wie gelegentlich in mehr pathetischen Zeiten, mit dem wahren Philosophen der DDR, also mit Wolfgang Heise. Der sitzt seit 1987 oben auf der Wolke zusammen mit Hölderlin und Hegel, neben Voltaire und Marx. Ich fragte ihn da oben: Soll ich, wenn demnächst deine und Hegels Nachfolger an der Humboldt-Universität mir das Diplom von damals aushändigen, soll ich dann auch den Ehrendoktortitel mir anhängen lassen? Heise lächelte und sagte: "Eigentlich nicht. Uneigentlich doch. Nimm die Ehrung an, schon aus Respekt vor denen, die ein Unrecht von vor 45 Jahren wieder gut machen wollen. Aber heikel ist solch ein Titel! Damen und Herrn, Sie hören jetzt ein Lied von Doktor Biermann... das klingt nach einem Rezept für Schmerztabletten. Also: Nimm den Titel an, aber verwende ihn nicht. Du brauchst keinen Titel. Und ein richtiger Philosoph bist Du, trotz des Studiums, nie geworden, du suchst ja nicht nach dem Absoluten wie unsereins. Für so Poeten gilt Goethes Replik in einem Brief an Schiller vom April 1801: Der Dichter braucht eine "gewisse gutmütige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt."
Wahre Worte des Johann Wolfgang von Heise. Vonwegen das Absolute ... Meine Diplomarbeit schrieb ich über ein absolut relatives Modethema: Max Benses Informations-Ästhetik, also eine Kritik der Anwendung mathematischer Methoden auf die Ästhetik. Der Tag heute ist mir eine gute Gelegenheit, über meinen Lehrer, den Philosophieprofessor Wolfgang Heise, zu sprechen. Ich will Ihnen erzählen, was passierte in diesem lehrreichen Jahr 1963, als ich die Prüfungen erst im Nebenfach Mathematik, dann im Hauptfach Philosophie an der Humboldt-Universität absolvierte. Nun halte ich - 45 Jahre später - das Diplom in der Hand, korrekt geschmückt mit Stempel und Unterschrift des neuen Chefphilosophen und von ihm und seinen Kollegen Bernd Wegener und Christoph Markschies überreicht: Lieber Professor Dr. Volker Gerhardt - danke!
Meine viel zu lange Rede ist nur ein kurzer prosaischen Anlauf, damit ich am Ende die poetische Summe ziehen kann, in einem neuen Lied. So sagen ja die Franzosen: "Et tout finit par des chansons". Der Titel des Liedes: "Voltaire-Chanson": Und unser Heise war ja mein DDR-Voltaire. Dieses Chanson beginnt in der ersten Strophe in kafkaesker Verrücktheit mit einer Fliege: "Was ist das für ´ne Fliege / Das ist gar keine Fliege / Sieht aus wie ´n Kind der Liebe / Aus Mücke und Hornisse ..." - Diese Fliege im Chanson ist eine von den Fliegen aus dem Drama des Existenzphilosophen Jean-Paul Sartre. "Les Mouches" sind Metapher für eine Metapher: für die Erinnyen, das sind die griechischen Rachegöttinnen, also die Quälgeister auch des edlen Muttermörders Orest. Diese Furien erscheinen als ekliges Insektengeschmeiß, wie Voltaires Nachgeborener Sartre es in Paris auf die Bühne brachte, während der Besetzung Frankreichs durch die Deutsche Wehrmacht.
Machen wir eine kurze Zeitreise. Zwei Jahre nach dem Mauerbau erwies sich dies verfluchte Jahr ´63 als lehrreich. Ich leitete damals, neben meinem Studium, das alternativ- alternaive "b.a.t." das "Berliner Arbeiter- und Studententheater" im Prenzlauer Berg. Und weil ich damals so begeistert wie kindlich war, wollte ich zudem auch klug sein. Also wurde ich Kandidat der SED. Schwankende Intellektuelle, zu denen die Nomenklatura auch die Studenten rechnete, brauchten in der DDR zwei Jahre Kandidatenzeit bis zur Mitgliedschaft als Genosse. Echten Arbeitern aber wurde von der Parteiführung ein gesunder Klasseninstinkt unterstellt, für die reichte ein Jahr im Kandidatenstatus.
Genosse der SED hatte ich werden wollen, damit ich nicht länger in meiner Funktion als parteiloser Prinzipal des "b.a.t."- Ensembles in der Belforter Straße eine Parteigruppe über mir hatte, der ich nicht angehöre und die ich also kaum hätte prinzipalisieren können.
Eine Mitgliedschaft in der Staatspartei strebte ich auch an, weil ich der Meinung war, daß wir jungen Kommunisten diese stalinistische Festung erobern müssen. Wir wollten die Kaderpartei SED entrieren, gegen das Pack der Monopol-Bürokraten. Ich hatte den Vers von Brecht an einen Genossen der Partei im Kopf: "Gehe nicht ohne uns den richtigen Weg, denn ohne uns ist er der falscheste." Und mir gefiel damals noch Brechts zynisches Credo: "Wofür wärest Du dir zu gut ... versinke im Schmutz, umarme den Schlächter, aber verändere die Welt, sie braucht es!"
Als ich 1963, nach zwei Jahren Wartezeit, endlich zum ordentlichen Mitglied der Partei gewählt werden sollte, stimmten die Studenten meiner Parteigruppe im 5. Studienjahr der Philosophie für mich - genauer: 17 Kommilitonen standen gegen 4, eine satte Mehrheit. Aber der anwesende Instrukteur der übergeordneten SED-Bezirksleitung Berlin erhob statutengerecht Einspruch. Und so mußte eine neue Parteiversammlung organisiert werden, in der abermals abgestimmt werden sollte, denn so funktionierte die undemokratische Praxis des "demokratischen Zentralismus". Inzwischen hatten die übergeordneten Funktionäre der Parteizentrale sich die Mitglieder meines Studienjahres einzeln vorgeknöpft. Und sie hatten Erfolg mit ihrem Überzeugungsterror.
Das nächste Abstimmungsergebnis lautete nur noch knapp 11 zu 10 für mich. Abermals kam das Veto vom Genossen aus Paul Verners Bezirksleitung. Na ja - und dann, bei der dritten Versammlung, stimmten endlich 20 gegen mich, und nur noch einer stand für den Kandidaten Biermann. Es war der Sohn des Arbeiterschriftstellers Ludwig Turek (n.b.: sein Buch "Ein Prolet erzählt" aus dem Jahre 1930) Mein falscher Turek hatte widerstanden, leider aber - wie ich dreißig Jahre später in meinen Akten las - im Auftrage des MfS. Die ganze Prozedur mündete in eine hexenjägerisch aufgeheizte Partei-Vollversammlung des Instituts, das heißt mit Teilnahme auch der Genossen des Lehrkörpers. Es hagelte vernichtende Statements aller Studienjahre gegen den Kandidaten. Der Direktor unseres Instituts, ein Professor Hermann Ley, führte routiniert das Wort. Dieser Genosse Ley war ein Doktor der Zahnmedizin, berühmt berüchtigt, weil er ohne Vorbereitung über jedes philosophische Thema einen einstündigen Vortrag halten konnte. Im Präsidium saß auch Heise, der eigentliche Kopf.
Wir verehrten diesen Mann mit dem gramgrauen Gesicht, wir bewunderten sein breites und tiefes Wissen und seinen stoischen Stolz. Solche beißwütigen Maulhelden wie Professor Doktor Ley beneideten heimlich ihren hochgebildeten Kollegen, fürchteten seinen Scharfsinn und verachteten seine altmodisch guten Manieren. Unter uns Studenten wurde kolportiert, daß der flotte Zahnarzt-Philosph Hermann Ley seine Doktorarbeit in der Nazizeit geschrieben hatte, mit dem Thema: "Karies und Rasse" - aber diese zeitgemäße Dissertation blieb unauffindbar, so wie heute auch die Dissertation des flotten Gregor Gysi. Ein böses bonmot kursierte: Ley ist der größte Philosoph unter den Zahnärzten und der größte Zahnarzt unter den Philosophen.
In dieser aufgeregten Versammlung trat unerwartet griesgrämig der gute Heise gegen mich auf. Auch er votierte gegen meine Aufnahme in die Partei mit einem sibyllinischen Satz: "Wolf Biermann ist kein Kommunist!" - Ich war verwirrt und wütend, ich verstand die Volte meines Lehrers nicht. Geschweige denn konnte ich damals schon ahnen, daß Heise mir eigentlich einen Gefallen tat. Als Jahre später sein Student Wolfgang Thierse in die SED reingepresst werden sollte, warnte Heise ihn mit dem dunklen Orakelspruch: "Wolfgang, tu ´s nicht, es ist nicht gut für dich."
Im gleichen Jahr 1963 war auch unser Hinterhof-Theater "b.a.t." im Prenzlauer Berg liquidiert worden. Wir wurden verboten, weil ich ein Stück geschrieben und dort inszeniert hatte über die Mauer. Meine Fabel erzählte eine tragische DDR-Liebesgeschichte aus den Tagen des Mauerbaus im August 1961, ein zehnmal verschlechtbessertes Theaterstück, in dem ich den Bau der Mauer erklärte, sogar verteidigte, aber sie eben nicht ideologisch verklärte als "antifaschistischen Schutzwall". Deshalb war unsere Aufführung, trotz all meiner faulen Kompromisse, nach der Generalprobe verboten worden. Die über hundert Arbeiter, Studenten und Berufskünstler, die dort zwei Jahre hart und begeistert aus einem stillgelegten Schluffen-Kino ein richtiges Theaterchen gebaut hatten, wurden auseinandergejagt wie räudige Hunde der Konterrevolution. Die zerbrechtete Kader-Canaille Manfred Wekwerth krallte sich das Haus dann als Regietheater für die Studenten der Schauspielschule "Ernst Busch".
Weil nun unsere Fürsten mir meine kleine Theater-Kanone weggenommen hatten, verlegte ich mich immer mehr auf poetische Handfeuerwaffen. Ich produzierte von da ab lieber Lieder und Gedichte. Meine Tonaufnahmen erlebten eine wundersame Vermehrung: Kopien kopierter Kopien verbreiteten sich extensiv, ja in geradezu geometrischer Reihe. Und meine Gedichte schrieben sich junge Leute im Osten heimlich mit der Hand ab: DDR-Samisdat.
Diese Turbulenzen waren wohl der Grund dafür, daß vom Politbüro des ZK der SED ein Hinweis aus der Bevölkerung kam, also ein Parteiauftrag von ganz oben an die Kreisparteileitung der Humboldt-Universität: Dieser politisch ungefestigte Biermann darf auf keinen Fall teilnehmen an den Prüfungen zum Diplom.
In jenen wirren Tagen nahm Wolfgang Heise mich beiseite und sagte: Wolf, Du solltest sofort, noch vor den Prüfungen - und für lange genug - krank werden, bitte eine schwere Krankheit. Die Gründe kann ich dir nicht sagen." - Ich verstand das Unverstehbare, fragte nicht groß nach, sondern lief Richtung Weidendammer Brücke zu einem Internisten, der hatte seine Praxis am Schiffbauerdamm. Er war, schon seit ich Mitglied des Berliner Ensemble wurde, mein Hausarzt und bald auch Freund geworden. Dieser Doktor "Goggi" Tsouloukidse lieferte ohne Umschweife seine Diagnose: Student Karl-Wolf Biermann hat eine progressive Herzkranzgefäßverengung, Gefahr eines Herzinfarkts. Rezept, Stempel, Unterschrift, Krankschreibung.
Solch eine unpolitisch-medizinische Dysfunktion funktionierte wie eine sportliche Auszeit im inner-sozialistischen Klassenkrampf. Eine solide Krankheit war politisch akzeptiert. Muskeln, Blut, Knochen, Nerven als ein letzter gemeinsamer humaner Nenner.
Meine Kommilitonen gingen also in die Diplomprüfungen - und ich fuhr nach Norden in die Sommerferien und erholte mich von dem Leiden, das ich nicht hatte. Paar Monate später, ich war zurück in meiner Wohnung Chausseestraße 131, wurden in der großen Politik von unseren dschugaschwilischen Schweinepriestern schon längst wieder andere Säue durchs Dorf getrieben. Es jagte ja eine Kampagne die andre. Und der Fall des kleinen Philosophie-Studenten war zum Glück viel zu unwichtig.
Nun also meldete sich mein Professor Heise und sagte: So, Wolf, nun solltest du schleunigst wieder gesund werden. Ich habe eine außerordentliche Prüfungskommission zusammengestellt, korrekt mit den vorgeschriebenen Professoren und Dozenten. Denke nicht, daß wir es Dir besonders leicht machen. Im Gegenteil: wir dürfen uns keine Blöße geben gegenüber Zuträgern und so ungnädigen Genossen wie Alexander Abusch und Paul Verner und Kurt Hager im Politbüro. Auf keinen Fall dürfen wir formale Regeln verletzen. Es wird Ärger genug geben. Dein Freund Walter Besenbruch soll dabei sein als ordentlicher Professor, und vermutlich Dr. Erwin Pracht wird mitmachen, der Hörz vielleicht."
Mir paßte Heises Mannschaft, denn den Ästhetik-Dozenten Erwin Pracht kannte ich gut genug, der wußte viel und verstand wenig, und war kein Lump. Den wahrhaft einäugigen Besenbruch respektierte ich. Der wußte zwar wenig, aber er verstand viel. Er war ein glasäugiges Naturtalent der Philosophie und hatte im Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel die Tiefen des Lebens studiert, als Häftling, genau wie mein Vater.
Wolfgang Heise und ich redeten, das fällt mir erst heute auf, niemals darüber, daß wir beide nach dem Gesetz der Nazizeit Halbjuden waren, im Jargon der Nürnberger Rassegesetze "Mischlinge Ersten Grades." Bedeutung hatte für uns nur, daß wir beide in diesem Heil-Hitler-Deutschland zufällig aus Kommunistenfamilien kamen. Sein Vater ein Intellektueller, mein Vater Hafenarbeiter. Heise war nach der Halacha jüdischer als ich, denn die Mutter war Jüdin. Ich aber war proletarischer, nach dem Klassenkodex des kommunistischen Katechismus.
Wolfgang Heise schrieb damals grade an seinem Buch "Aufbruch in die Illusion", das im VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1964, veröffentlich wurde. Der Untertitel zeigt schon, wo bei Heise der Hase langlief: "Zur Kritik der bürgerlichen Philosophie in Deutschland" - also eine marxistische Abrechnung mit verschiedenen Ideologien im Westen.
In dem Kapitel "Geschichte der Philosophie - ein Erkenntnisprozess" beruft Heise sich auf Hegels Philosophie der Geschichte wie auf Hegels Geschichte der Philosophie gleichermaßen. Er prangerte parteitreu die anti-aufklärerischen Tendenzen im Westen an: "Die Wendung zur Religion ist charakteristisch für die Bürgerliche Philosophie am Ausgang des Kapitalismus. Sie ist eine aktive Negierung des Wesens der Philosophie als wissenschaftliche Erkenntnis und damit zugleich Wendung gegen die Geschichte der Philosophie. Denn diese ist im ganzen ein Prozess fortschreitender Erkenntnis, der Weg vom Nicht-Wissen zum Wissen, von roher Ahnung über kühne Spekulation, über Rückfälle in vorphilosophische Vorstellungen und Geisteshaltungen hin zu wissenschaftlicher Einsicht - und zwar zur Philosophie des Marxismus-Leninismus." - O ja, Heise sah die westliche Welt als eine am Rande des Abgrunds, also am "Ausgang des Kapitalismus" - dabei befanden wir uns längst in der Endphase des todkranken Sozialismus! Mein kluger Freund predigte, wenn auch vom Zweifel gepeinigt, parteifromm die Religion des Marxismus-Leninismus, obwohl wir längst in der Epoche nach dem XX. Parteitag der KPdSU lebten, als der kommunistische Tierversuch an der Menschheit ja schon vor aller Augen gescheitert war. Ich vermute: Unser geliebter Lehrer wußte um all das selber und wohl auch tiefer als wir Anfänger.
Er wollte wohl die Wahrheit partout nicht wahr haben, daß der kommunistische Versuch, das Himmelreich auf die Erde zu zwingen, scheitern muß - biblisch gesprochen - er predigte noch immer den Irr-Weg ins soziale Narrenparadies, ins marxistische Nirwana, in den Garten Eden, darin der Löwe dem Schaf auch noch das Gras wegfrißt. Dieser irrationale Erlösungsweg hatte sich als realer Weg in die Höllen des GULag erwiesen. Die marxistische Endlösung der sozialen Frage hatte bewiesen, daß die Utopie wirklich das ist: ein Un-Ort, hinter Stacheldraht.
Hätte aber nun Wolfgang Heise bei seiner Attacke gegen die Illusionen der Westideologen offen zugegeben, daß er selbst die schlimmste Illusion von allen hat, zudem die plumpeste: Die Illusion, ihn selber habe gar keine Illusion, ja, dann hätte das Buch in der DDR nicht erscheinen können.
Daß mein hin- und hergerissener Professor gegen die Anweisung der Obrigkeit mich die Prüfungen doch hatte machen lassen, blieb nicht unentdeckt. Aus dem ZK kam nun der hysterische Parteibefehl, diesem Biermann auf keinen Fall die Dokumente mit Stempel und Unterschrift auszuhändigen. Mir wurde all das damals immer egaler. Ich wollte sowieso nicht Philosoph werden, sondern Drachentöter. Ich brauchte keinen staatlichen Stempel auf meine Gitarre, will sagen: auf das Holzschwert mit den sechs klingenden Nylon-Saiten.
Im Dezember 1965, brach über uns alle eine heilsame Desillusionierung herein, ein Schock: das 11. Plenum des ZK der SED. Damals wurde der junge Wolf Biermann neben den Alten Robert Havemann und Stefan Heym an den Pranger gestellt. Wir drei Ketzer wurden mit Pauken und Trompeten entgnadet und exkommuniziert. Für mich, den Novizen, erwies sich das totale Verbot als eine enorme Erleichterung und Beförderung. Die schönen Töchter der Göttin Mnemosyne, die Musen Erato und Polyhymnia, küßten mich leidenschaftlicher als vordem. Bei mir war nun endgültig Schluß mit dem Versuch, taktisch zu sein, Schluß mit den schlauen Kompromissen.
Ich hackte mir fortan keinen Fuß mehr ab, um besser voran zu kommen.
Nun hatte sich also der Biermann endgültig entlarvt als Konterrevolutionär und Renegat, als ein gekaufter Agent des Klassenfeindes. Für Professor Heise aber wurde mein Fall ein Sturz. Nun präsentierte die Partei ihrem ungehorsamen Genossen die Rechnung aus dem Jahre 1963. Ein Parteiverfahren gegen Heise wurde durchgezogen. Er selbst machte wenig Worte darüber, aber es wird hier im Saal Fachleute geben, die womöglich dabei waren und es besser wissen und die sich auch genauer erinnern als ich.
Das erinnere ich: Wolfgang Heise verlor die Position als Professor für die Königsdisziplin: Philosophiegeschichte. Er wurde abgestellt auf ein Nebengeleis, wo er nicht so viel Schaden anrichten konnte: Ästhetik.
Diese Degradation liefert mal wieder ein Beispiel für lebendige Dialektik. Wir verdanken dieser Strafversetzung das vielleicht tiefsinnigste Werk von Heise mit dem Titel: "Hölderlin - Schönheit und Geschichte" - manche behaupten, es sei Heises Opus magnum. Es erschien ein Jahr nach meines Lehrers Tod, und also ein Jahr vor dem Tod der DDR. Dieses Buch ist eine subtile und subversive Liebeserklärung an die Schönheit als ästhetische Kategorie: Schönheit als atheistischer Gottesbeweis für Fortschritt, für Wahrheit und Humanität im Geschichtsprozess.
Heise und ich blieben Freunde. Manchmal spielte ich ihm und seiner Frau Rosi und den Zwillingen zuhaus, draußen in Hessenwinkel, paar Lieder vor. Ich besuchte ihn dort, wenn ich auf dem Weg raus nach Grünheide war, zu Robert Havemann, meinem besten und stärksten Freund in all den Jahren. Heise - immerhin - wollte immer auf dem neuesten Stand meiner Dummheit sein, er machte sich Sorgen um seinen eigensinnlichen Schüler, wollte wissen, ob sein ungezogener Zögling noch was Brauchbares zustande bringt.
Wie in Notwehr schrieb ich damals, mitten in den Tagen des kulturfeindlichen Kulturplenums des ZK der SED, meine aggressive Populärballade. Nun unsere Herren mich knebeln wollten, nahm ich schon gar kein Blatt mehr vor den Mund. So sang ich also:
Warum die Götter grad Berlin
Mit Paule Verner straften
Ich weiß es nicht, der Gouverneur
Ließ neulich mich verhaften
Das Kreuzverhör war amüsant
Auch für die Kriminalen
Ich wette dieses Kreuzverhör
Geht ein in die Annalen
Mit Marx und Engelszungen sang
Ich, bis sie Feuer fingen
So brachten die im Kreuzverhör
Noch keinen Mann zum Singen
Das ist der ganze Verner Paul
Ein Spatzenhirn mit Löwenmaul
Der Herr macht es sich selber schwer:
Er macht mich populär!
Sie sehn ja selbst: das ist keine enigmatische Lyrik in den verschlüsselten Metaphern der Sklavensprache. Im Strafgesetzbuch der DDR wurden solche Verse als politische "Hetze" gewürdigt, für dermaßen offene Attacken drohte einem der gefürchtete Gummiparagraph 106. Paul Verner, damals unser Oberaufseher in Ostberlin, war ein besonders gefürchteter und verachteter Betonkopf im Politbüro der SED. Und gleich in der nächsten Strophe knallte ich auch den Provinzchef der Partei im Bezirk Halle an und krähte im Refrain des Spottliedes wie ein Berliner Straßensänger in Knüttelversen:
Ach Sindermann, du blinder Mann
Du richtest nur noch Schaden an
Du liegst nicht schief,
Du liegst schon quer:
- Du machst mich populär!
Das war nicht grade Heises Tonart. Als ich Heise nun dieses Pasquill vorsang, verzog er verächtlich den Mund. Solche persönlichen Angriffe, noch dazu mit Namensnennung! Er tadelte mich: "... nein, Biermann, das geht nicht, und du gehst zu weit!" Ich widersprach: "Aber wir müssen doch ein bißchen zu weit gehn, allein schon deshalb, weil all die Feiglinge immer viel zu kurz gehn!" Und Heise dagegen: "Gewiss zu weit, aber nicht zu weit zu weit!" Darauf ich: "Aber nimm François Villon! der nannte in seinem Großen und im Kleinen Testament doch seine Feinde auch beim Namen, die großen Fürsten und die Gauner bei den Coquillards. Kein Aas kennt die Muschelbrüder heute noch. Dagegen er: "Du bist kein Villon, und die Genossen sind weder Fürsten noch Ganoven. Und die Kommunisten im ZK sind nicht unsre Feinde, sie sind Andersdenkende, die sich manchmal irren, wie ja auch du und ich. Außerdem ist das an den Pranger stellen der Namen keine Dichtung, sondern Kabarett ... und im Grunde unmarxistisch! Wir Kommunisten wollen uns nicht verbeißen ineinander wie Hunde, damit dann die Klassenfeinde genüßlich das Blut lecken. Und wenn etwas schlecht und falsch ist bei uns, dann wollen wir die gesellschaftlichen Strukturen analysieren, wollen solidarisch kritisieren. Es geht voran nur mit der Partei. Fehler korrigieren können wir niemals gegen die Partei..." Nun ja, meinen Professor bekümmerten solche grobianischen Verse:
Im Neuen Deutschland finde ich
Tagtäglich eure Fressen
Und trotzdem seid ihr morgen schon
Verdorben und vergessen
Heut sitzt ihr noch im fetten Speck
Als dicke deutsche Maden
Ich konservier Euch als Insekt
Im Bernstein der Balladen ...
Und steht der Vers auf Sindermann
Im Lesebuch der Kinder dann
Wird er, was er gern heut schon wär:
Na, was wohl? - populär!
"Stabreime sind keine Argumente!" - stöhnte mein Lehrer. "Außerdem landest du damit in Bautzen. Und es ist zudem menschenverachtend: dicke deutsche Maden ... Insekt ... im Bernstein der Balladen ... Hitler nannte die Juden Ungeziefer... " - Und ich dagegen: "Das ist eine Metapher, die Heinrich Heine erfunden hat...!" - Nun aber Heise: "Du bist nicht Heine. Und keiner kann es noch sein, weil wir nicht mehr wie Heine und Villon in der antagonistischen Klassengesellschaft leben, sondern ..."
Und dann ich schon wütend: "... sondern?!!!"
An solchen taktischen Sollbruchstellen brach unser Gespräch ab. Beim nächsten Besuch saßen wir wieder brüderlich beisammen. Heise hielt mir geduldig das gute Beispiel Heiner Müller vor die Nase. Ja Müller! das war ein Dichter nach Heises Herzen. Auch meinen Freund Volker Braun empfahl Heise mir als Vorbild! Solche Dichter schrieben komplexer, sie waren geschichtsbewusster, die kämpften womöglich klüger. So argumentierte Heise: "Der Müller kritisiert unsere Gesellschaft ja auch radikal ... aber nicht so romantisch aggressiv ... nicht so grob, nicht so feindselig gegen konkrete Personen. Du solltest poetisch überhöhen und vertiefen, wie es Dir gelungen ist in Deinem starken Barlach-Lied. Ja, wenn Du es von mir nicht annehmen willst, dann lerne es gefälligst von dir selber! Beherzige, was Brecht sagt über die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, verwende die Verfremdungs-Techniken, nutze die Fabel, Galileis List der Vernunft, den griechischen Mythos als Modell, das Häßliche als Parabel, das Schöne als Gleichnis. Genial, wie Heiner Müller die Geschichte des Philoktet auf die Bühne bringt. Am Beispiel des Griechen vor Troja versteht dann jeder bei uns in der DDR, daß die Partei einen kritischen, aber unentbehrlichen Genossen eben nicht aus dem Kollektiv der Kämpfenden ausstoßen darf, nur weil ihn unterwegs auf der Insel eine Schlange gebissen hat und seine Wunde nun schwärt und unerträglich stinkt und weil die Genossen seine Schmerzensschreie nicht mehr aushalten ... und wie der Ausgestoßene dann doch wieder dazugehört. Du darfst kein stinkender Philoktet werden, dessen Geschrei die führenden Genossen nicht aushalten. Du kennst doch den Spruch: "Der Helm eines echten Bolschewiken hat viele Beulen - und nicht alle stammen vom Klassenfeind!"
Ja: Geist und Macht ... Die Intelligenzia gerät immer wieder in die Bredouille mit dem Problem, das Brecht geschildert hat in seinem TUI-Roman-Fragment: dem Buch der Wendungen. Er beschreibt die Intellektuellen, die direkt oder indirekt sich verkaufen oder sich vermieten an die Herrschenden. Brecht nannte diese systemkonformen Intellektuellen verballhornt "Tellektuelinns" und kürzte das Unwort Tellektuelinn ab zum lapidaren Schmähwort TUI. Daß Brecht selbst ein TUI geworden war und es durchschaute - etwa in Ostberlin, als die sowjetischen Panzer aus den streikenden Arbeitern Hackfleisch machten - darüber findet sich kaum etwas in Brechts Werk.
Sie sehen schon: Mich erinnert das Beispiel Brecht auch an meinen Lehrer Heise, der immer beides war, ängstlicher TUI und zugleich tapferer Soldat in dem, was Heinrich Heine in seinem Gedicht "Enfant Perdu" den ewigen Freiheitskrieg der Menschheit nannte.
Als eine Elite der DDR-Schriftsteller nach dem Kölner Konzert im November 1976 gegen meine Ausbürgerung protestierte, da unterschrieb Heise die beim Klassenfeind im Westen veröffentlichte Petition von Stephan Hermlin & Co. nicht. Er schrieb lieber einen Brief an den obersten Ideologiewächter im Politbüro, an Kurt Hager. Heises Pamphlet war klug, war radikaler als die Protest-Petition, denn er ging tiefer an die Wurzel des politischen Übels. Aber der tapfere Text blieb damals unveröffentlicht, und das bedeutet leider: Das Politische blieb unpolitisch.
Daß Heise zwei Jahre vor seiner haßgeliebten DDR an einem Herzinfarkt starb, paßt in mein Bild von ihm und paßt zu dem Refrain meines Liedes mit dem Voltaire-Zitat: "Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire." Ja, er nahm sich die DDR zu Herzen, und das erwies sich als tödlich - er starb, genau wie Brecht, zwanzig Jahre zu früh.
Der Philosoph Wolfgang Heise war das, was die Jidden so nennen: "a mensch".
Er hat mein Herz berührt, wie es bei Voltaire geschrieben steht: Ce qui touche le cœur, se grave dans la mémoire ... das was mein Herz erschüttert, im Guten wie im Bösen, - das gräbt sich tief ein ins Gedächtnis. Also gedenke ich seiner ... aber nicht mit Nachsicht, sondern mit Liebe.
Voltaire-Chanson
Was ist das für ´ne Fliege ?
Das ist gar keine Fliege !
Sieht aus wie ´n Kind der Liebe
Aus Mücke und Hornisse
Hat hinterm Kopf zwei Risse
Giftgelb auf schwarzem Grunde
Und ich hab Angst vor diesem Tier
Es fliegt mir auf mein Blatt Papier
Und landet grad auf dem bon mot
Zwei Zeiln, die von Voltaire sind
Wie´n Lied-Refrain, der einsam steht
Und sich nach zwei drei Strophen sehnt:
Ce qui touche le cœur
se grave dans la mémoire
Passé! der Todesstreifen
Totalitäre Possen
Die machtbesoffnen Fressen
Allmächtiger Genossen
Die rotgetünchten Phrasen
- ich hab das Pack vergessen
Vergaß den Stacheldraht im Hirn
Die Ketten, die im Innern klirrn
Doch daß mit falschem Slüsselin
Die Stasi d i r ! mein Herz rausriß
Das wird den Mördern nie verziehn
Das bleibt mir bis zum Tod gewiß
Ce qui touche le cœur ....
Der Krieg der falschen Brüder
Im Jahre Achtundsechzig
Schwamm drüber und vergeben
All die Millionen Opfer
Von Bautzen bis Workuta
Gott, damit muß ich leben
Die Massenmorde steh ich aus
Es stirbt der Mensch halt wie ´ne Laus
Doch riß dies Pack mir meinen Sohn
Vom Herzen in dem Tierversuch
Das werd ich nicht und nie verzeihn
Herrn Honeckers Gesangsverein
Ce qui touche le cœur ....
Mein Lehrer Wolfgang Heise
Im Krieg der Illusionen
Ein Waisenkind der Weisheit
Und ist daran zerbrochen
Brach auf zur letzten Reise
Im Jahre Sieb´n-und-achtzig
Prometheus der Parteiraison
Hat haßgeliebt sein Vaterland
Sein Herz blieb stehn aus Rebellion
Er war mein DDR-Voltaire
Denn er durchschaute immer schon
Auch seine eigne Illusion
Ce qui touche le cœur .....
Mémoire? Mémoire frißt ja
Mein Herz. Ich will vergessen !
Nicht Kummer-Steine fressen!
Den Schmerzensbiermann machen!
Nicht nur zum Weinen ist ja
Zum Lächeln und zum Lachen
Ist dieses Leben auch. - Mémoire
Macht mir mein Herzleid unheilbar
Mensch, beides lähmt die Lebenslust
Zu wenig und zu viel gewußt
Trotzalledem gefällt mir der
Bonmot-Refrain vom Herrn Voltaire
Ce qui touche le cœur
se grave dans la mémoire
Das Schweigen der Quandts
Lobrede am 16.10.08 im WDR Köln für einen Film von Eric Friedler
Lieber Eric Friedler, es wird Sie nicht wundern: Der Film über das Schweigen der Familie Quandt riß bei mir alte Wunden auf, erinnerte mich an die Qualen der Häftlinge in den Kerkern und in den Konzentrationslagern der Hitlerzeit. Dieses Elend ist mir grauenhaft vertraut von Kindheit an. Der Hamburger Kommunist Biermann geriet als Widerstandskämpfer sechs Jahre in den Knast und wurde dann, weil er ja nebenbei auch noch Jude war, im Februar 1943 aus dem Gefängnis Bremen-Oslebshausen entlassen - direkt nach Auschwitz. Mein lieber Vater hatte dort leider keine Chance mehr, für Hitlers Kriegsindustrien zu schuften wie die Arbeitssklaven der Familie Quandt. Dagobert "Israel" Biermann entkam der Gaskammer nicht durch Arbeit für die IG-Farben oder für Quandts Batterie-Fabrik. Er durfte im KZ Auschwitz nicht mehr für die UNION-Munitionsfabrik arbeiten und nicht für die Deutschen Hydrierwerke in Blechhammer malochen, wie mein Freund, der Historiker des Jüdischen Widerstands, Arno Lustiger aus der Stadt Bendzin in Polen.
Durch Zufall beim Zappen war ich in den Film über die Quandt-Familie geraten. Und hatte mich gleich davonzappen wollen zu einem Fußballspiel. Aber mein Finger auf der Fernbedienung verkrampfte sich.
Dabei kenne ich all das! und doch konnte ich den Blick nicht abwenden.
Der Film "Das Schweigen der Quandts" liefert weder das Schweigen der Lämmer noch die Todesschreie der Lämmer. Eric Friedler zeigt die Schlächter, die unmittelbaren und auch die indirekten, mit Bildern, mit Fakten und Zeitzeugen. Der Film schreit die Wahrheit aus, daß am immensen Reichtum dieser deutschen Industriellen-Familie, das Blut der KZ-Häftlinge klebt. Unschuldiges Blut am besten Auto der Welt: BMW. Das mochte für manche die Sensation sein, aber nicht für mich.
Mir blieb das Herz stehn und der Mund offen, als im hinteren Teil des Filmes die Passage kam mit dem unschuldigen Quandt-Erben Sven! Ich ließ die Sentenz im Computer noch mal zurücklaufen, so konnte ich mir das goldene Wort korrekt notieren: "Wie kann ich dafür verantwortlich sein. Habe ich da gelebt? Nein."
Diese brachiale Unschuld erschütterte mich und hat mich das Fürchten gelehrt. Dem smarten Quandt-Enkel wird im Film die Chance gegeben, sich bis zur Kenntlichkeit vorzuführen. Er ist immerhin das einzige Mitglied dieser schwarzbraunen Familien-bande industrieller Lichtgestalten, das sich vor die Scheinwerfer der Kamera von Eric Friedler wagte. Dieser Mensch lieferte uns kaltlächelnd sein Credo: "Wie kann ich dafür verantwortlich sein. Habe ich da gelebt? Nein" - diese elf Wörter waren die Sensation, sie haben mich erschüttert. Sowas nenne ich vollendete Geschichtslosigkeit.
Genau so! dachte ich, muß eine wirkungsmächtige Geschichtslüge formuliert werden: jedes Wort wahr! Der Quandt-Erbe Sven wurde elf Jahre nach dem Krieg geboren. Dieser elegante 2-Meter-Mann genießt also die Gnade der späten Geburt. Weder im Kopf noch im Herzen weiß er offenbar, wessen Eigentum eigentlich der sauteure Renn-Jeep ist, mit dem er Afrikas Wüsten verwüstet, wenn er begleitet vom eigenen Racing-Team, bei der Ralley über die Pisten fliegt und rumpelt und crasht. Dieser hightec- aufgebrezelte Rennwagen, dachte ich, kostet mehr als eine Villa, aber der ist eigentlich das Eigentum des alten Mannes, der da durch das überwucherte Werksgelände der Quandtschen Accumulatoren AG tappert. Carl-Adolf Sörensen. Diesen alten Mann aus Dänemark kann Friedler uns im Film zeigen, weil er das firmeneigene Quandt-KZ in Hannover überlebt hat. Es ist ein verstörter und störrisch aufrechter Mensch, einer von all denen, die in den Fabrikhallen von Günter und Herbert Quandt, bewacht von der SS, ohne irgendeine Schutzkleidung hatten schuften müssen, in der irdischen Hölle der Werkhallen, in den Baracken des Lagers, wo diese Quandt- Sklaven dann auch starben wie die Fliegen. Sie krepierten an den Bleivergiftungen und an den Chemikalien, an Hunger und Kälte und Folter.
Das scheint seit Urzeiten ein Grundgesetz der Menschheits-Geschichte zu sein: Am Ende einer blutigen Tyrannei, nach dem Zusammenbruch dieses oder jenes Willkürregimes, nach dem Sturz einer mörderischen Diktatur sind Mörder keine Mörder, Folterknechte keine Folterer, Nutznießer keine Nutznießer. Alle Täter sehen sich als Opfer. Und ihren Opfern verzeihen die Täter nie. Kein Verbrecher zieht die Konsequenz und nimmt die Schuld auf sich. Da gibt ´s kein mea culpa, kein "Es tut mir leid ..." - kein kindliches "Ich will es auch nimmer wieder tun!" Geschweige denn gestotterte Scham im kleinlauten Ton - ach! keine Red davon!
Der NSDAP-Genosse, der mächtige Wehrwirtschaftsführer Quandt rettete sich 1945 vor den Nürnberger Prozessen durch die tolldreiste Behauptung, er sei im Grunde sogar ein Verfolgter des Naziregimes gewesen. Er lotste sein Vermögen durch die Untiefen und Unwetter der Nachkriegszeit in die Epoche der Demokratie. Sein Sohn Herbert, Vater von Sven Quandt, hatte im richtigen Moment ein Händchen, denn er kaufte 1959, auch mit dem geretteten Blutgeld, billig die bankrotten Bayrischen Motoren-Werke und machte sie zum Weltkonzern BMW.
Unter uns, das Beispiel Sven Quandt empört mich nicht nur, in Wahrheit rührt es mich auch. Dieser Mensch wurde geprägt von chronischen Schuldverleugnern, wie soll er da sich verantwortlich fühlen für eine Schuld! Wie kann einer anerkennen, was er gar nicht erkennen kann! Wir spielen doch alle ein bißchen Gott und formen unsere Kinder nach dem eigenen Ebenbild. In diesem Sinne ist der reiche Erbe der verwandten Täter auch ein armes Opfer.
Aus der Perspektive politischer Moral finde ich den Status des aufreizend unbekümmerten Rallye-Piloten jedenfalls nicht so skandalös wie das zynische Schmierentheater, das seit dem Zusammenbruch der DDR uns von der Nomenklatura der SED und von den Offizieren und Spitzeln des MfS vorgespielt wird.
Diese Canaillen leugnen lachend, leugnen aggressiv und selbstgerecht ihre Verbrechen. Die haben ihre Schäfchen ins Trockene gebracht, die leben gemütlich von den Renten und hohen Pensionen aus der Schatulle des alten Klassenfeindes. Und diese entmachteten Allmächtigen genießen vor allem klammheimlich die Erlösung von den ewigen Ängsten vor dem eigenen totalitären Machtapparat.
Der smarte Kapitalist Sven Quandt ist also nicht so verlogen und verkommen. Er leugnet ja nicht die Verbrechen der Nazizeit, und er ist ja, wie meine Kinder sagen würden: als Kind der Quandt-Familie "in echt" unschuldig. Aber er entzieht sich offensichtlich der Verantwortung für die Verbrechen, deren unmittelbarer Nutznießer er ist. Auf diese fatale Weise wird er mit einer Zeitverzögerung von sechs Jahrzehnten zum induktiven Mittäter. Und das genau ist für mich die Sensation des Filmes: Eric Friedler bringt dieses Lehrbeispiel schuldloser Schuld kühl und klar zur Erscheinung.
Aber wie gesagt - ich lebte in beiden deutschen Diktaturen und also denke ich auch bei Gelegenheit dieses Films über die Nachgeborenen der Nazizeit mit Kummer und Zorn auch an die politischen und materiellen Erben der zweiten Deutschen Diktatur. Die Nomenklatura der DDR hat nicht etwa Millionen, sondern Milliarden des Reichtums der armen DDR beiseite geschafft und rechtzeitig global geparkt, als Firmeneigentum, Kapital auf Konten, als Immobilien, als Aktien in verschachtelten Besitzstrukturen über Privatpersonen, an die kein Wirtschaftskriminalist jemals herankommt. Sie sollten bedenken, dass die bankrotte DDR im Vergleich zur Menschheit, zu der wir ja ganz nebenbei auch noch gehören, trotz der realsozialistischen Planwirtschaft damals der zehntstärkste Industriestaat der Welt war. Im Ostblock war die DDR das mit Abstand reichste Land, aus Moskauer Sicht ein Wohlstandsparadies. Über die kaltschnäuzigen Verweser des Kapital-Imperiums, das einst Schalck-Golodkowski für die wahren Besitzer des Volkseigentums so genial gemanagt hat, wird vielleicht der Sohn von Eric Friedler mal einen erschütternden Film dieser Art drehn, in, sagen wir, etwa dreißig Jahren. Denn auch Eric Friedler spielt Gott und formt seine Kinder nach dem eigenen Ebenbild.
Der berühmteste Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen:" gilt auf teuflisch dialektische Weise auch für das Schweigen der Familie Quandt. Und so schweigt sie eben!
Es ist eine große Leistung, dass Eric Friedler uns nicht mit seinem eigenen Zorn und schon gar nicht mit seinem Entsetzen behelligt hat. Er lieferte uns einen Dokumentarfilm, der auch ohne die verlogene Äquidistanz auskommt, ohne dieses political correcte Pose, ohne dieses feige Einerseits-Andererseits. Aber Friedler und seine Crew liefern uns genau die Fakten, den klar strukturierten Stoff, den wir brauchten, um unser eigenes Urteil zu festigen oder auch zu korrigieren. Mehr kann so ´n Werk nicht leisten, aber weniger darf man von einem solchen Film auch nicht erwarten.
Ja ja, das ewige Problem mit der Schuld! Die Schuldigen waren alle unschuldig am Ende der Nazizeit, die kleinen Lumpen wie die großen. Mir gelang es allerdings doch, einen Hauptschuldigen zu finden, und den will ich bei dieser Gelegenheit beim Namen nennen: Es ist der österreichisch-britische Philosoph Ludwig Wittgenstein. Sie alle hier im Studio des WDR haben es ja noch frisch im Ohr, dieses schon fast stumpfzitierte Wittgenstein-Wort: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen" Der Vater des Philosophen war ein schwerreicher Stahl-Industrieller in der Donau-Monarchie. Und der vererbte seinem superklugen Sohn damals ein gewaltiges Millionen-Vermögen. Der junge Jude Wittgenstein hatte aber als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg zu viel Tolstoi gelesen. Also verteilte er seines Vaters Millionen unter anderem an den avantgardistischen Architekten Adolf Loos, an den expressionistischen Dichter Georg Trakl und an seinen Lieblings-Lyriker Rainer Maria Rilke.
Es ist nun aber ein Zufall, daß der ganz junge Wittgenstein in Österreich ab 1903 die Realschule in Linz besucht hatte. Als ich nun ein Foto aus diesen Jahren entdeckte, auf dem der jüdische Knabe Wittgenstein abgebildet ist, zusammen mit einem Schüler aus Braunau: dem späteren Judenfresser Adolf Hitler, da wurde mir klar, wer Schuld ist an allem, am Siegesgebrüll der Nazis und also auch am Schweigen der Quandts. Tja, hätte damals dieser meschuggene Ludwig Wittgenstein, statt sein Erbe so großherzig zu verschleudern, großzügig dem mittellosen jungen Postkartenmaler Adolf Hitler im richtigen welthistorischen Moment ein Maler-Atelier gekauft und übereignet, egal in Wien oder in München, dann hätte es die ganze Nazibewegung womöglich überhaupt nicht gegeben, keine Machtergreifung 1933, keinen Zweiten Weltkrieg und keine Shoa. Also war mal wieder der Jude an allem Schuld!
Rein marxistisch ist solch eine rückwärtsgerichtete Geschichtsprognose nicht zu halten, denn nach der marxistischen Auffassung von der Historie als einer Geschichte von Klassenkämpfen, wäre eine Diktatur der kapitalistischen Monopolbourgeoisie auch dann über uns gekommen, wenn der Säugling Adolf in Braunau an Blattern gestorben wäre. Aber wenn wir an des Soziologen Max Webers Theorie von der charismatischen Herrschaft denken, dann leuchtet mein Deutungsversuch wohl ein. Der Kelch wäre an uns allen womöglich vorüber gegangen; Ohne den verführerischen Führer hätte es kein Heil-Hitler-Deutschland gegeben, also auch keinen PG Quandt und logo: Wir hätten auch nicht uns heute hier im Studio des WDR getroffen, um den Dokumentarfilm "Das Schweigen der Quandts von Eric Friedler zu feiern, ein Werk, das gut genug ist für den angesehenen Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis in Köln.
Jüdischer Selbsthaß und Haß auf Juden
Tacheles zum Theodor-Lessing-Preis am 6. März 2008 in Hannover
Verehrte Damen und Herrn, Freunde der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Mich freut dieser Preis für aufklärerisches Handeln, obwohl ich um die Grenzen der Aufklärung weiß. Gern schmücke ich mich mit dieser Ehrung, obgleich mir klar ist, daß andere Streiter für Menschenrechte - Heinrich Heine würde sagen: andere „Soldaten im Freiheitskrieg der Menschheit“ - solch eine Würdigung eher verdienen. Es gibt viele tapfere Männer und Frauen, die aber in unserer Brave New Medienwelt nicht so groß im Lichte stehn.
Daß Ihre Wahl auf mich fiel, zwingt mich, eine kleine Rede zu halten, und so will ich die läßliche Todsünde gestehen, daß ich nur wenig über den Namenspatron dieses Preises gehört, nichts von diesem Theodor Lessing gelesen hatte. Mir reichte bisher voll und ganz der Nichtjude Lessing: Gotthold Ephraim Lessing, der deutsche Dichter der Aufklärung. Dieser Goj ist mir im Übrigen auch jüdisch genug, denn der hat ja seinem Zeitgenossen Moses Mendelssohn, dem deutschen Philosophen der jüdischen Aufklärung „Haskala“, das Hohelied der Toleranz, das Versdrama von Nathan dem Weisen auf den Leib geschrieben.Inzwischen kenne ich die romanhafte Lebensgeschichte des Kulturphilosophen Theodor Lessing und auch die blutige Ballade seines Todes.Ich las nun von Lessing „Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen“, ein Titel aus dem Jahre 1919, der einen getrimmten Marxisten wie mich zwanghaft zum Widerspruch reizt. Diese Geschichtsphilosophie kommt offenbar aus zwei Quellen: Erstens aus dem Entsetzen über das sinnlose Gemetzel des 1. Weltkrieges, zweitens aus einem Aphorismus des Friedrich Nietzsche. In seinem Werk „Morgenröte“ spottet der Dichterphilosoph über die „...sogenannte Weltgeschichte, welche im Grunde ein Lärm um die letzten Neuigkeiten ist ...“.
Und ich kenne inzwischen Lessings Buch „Der jüdische Selbsthaß“, das ja auch von den Nazistudenten bei der Bücherverbrennung grauenhaft geehrt wurde, als es im Mai 1933 in Berlin und hier in Hannover in die Flammen eines Autofafé geworfen wurde und zusammen mit Brechts und Heines Werken als Rauch aufstieg, so wie dann mein Vater, der Schlosser-Maschinenbauer Dagobert „Israel“ Biermann, genau zehn Jahre später in Auschwitz.
Als die Nazis am 30. Januar 1933 an die Macht gekommen waren, hatten alle flagellantischen Kompliziertheiten des jüdischen Selbsthasses gar keine Bedeutung mehr. Theodor Lessing packte einfach die Koffer und floh mit seiner Frau Ada nach Marienbad, also nach Böhmen in die Tschechoslowakei.Ich wußte von diesem großbürgerlichen Kurbad bisher nur, daß der greise Goethe der achtzehnjährigen Ulrike von Levetzow dort begegnete und dann seine Marienbader Elegie schrieb. Dort nun wollte das Ehepaar, so schön nahe an der Grenze zum Dritten Reich, eine Schule gründen für jüdische Emigrantenkinder. Was für ein umgekehrter Don Quijote! Lessing hielt die blutrünstigen Riesen offenbar für Windmühlen ohne Beine. Fünf Jahre später marschierte die Wehrmacht ein - da hätten die Exilierten weiterflüchten müssen. Aber diese Flucht blieb dem Philosophen erspart: Goebbels setzte damals einen Kopfpreis von 80 000 Reichsmark auf Theodor Lessing aus. Auch das war eine Form der Würdigung. Diese Summe entspricht einer Million Euro. Und so haben zwei simple sudentendeutsche Nazis den Philosophen einfach durchs Fenster in seinem Arbeitszimmer abgeschossen. Das passierte im August 1933. Später bot das Deutsche Reich nicht mehr solche Unsummen für den Tod eines einzigen Juden.
Von solch einer Extravaganz hatte ich noch nie gehört, und also verblüffte es mich: Anders als legendäre jüdische Selbsthasser, die wir etwas besser kennen, anders also als etwa Otto Weininger oder Karl Kraus oder Maximilian Harden war dieser Theodor Lessing eine Stufe komplizierter: Auch er war aus Liebeskummer mit Germania ein jüdischer Selbsthasser geworden, aber immerhin einer, der mit nietzscheanischer Radikalität seinen Haß von Herzen haßte. Weil Theodor Lessing sich anders seine gescheiterte Liebe wohl nicht erklären konnte, beneidete er den Übermenschen Nietzsche, wie auch seinen Jugendfreund, den teutschen Proto-Ökologen und Lebensphilosophen Ludwig Klages, um deren germanische Wurzeln im vital Barbarischen, im Nationalen, im antichristlich Heidnischen, im Völkischen. So suchte Lessing nach seinen wirklichen Wurzeln im jüdischen Volk. Und das fand er im Osten. Darum liebte er nun romantisch diese Ostjuden, nun verklärte der Aufklärer als reifer Mann ausgerechnet die plebejischen frommen Jidden, die ja von den aufgeklärten, den assimilierten und akkulturierten Juden in Deutschland verachtet wurden.Die ordinäre jüdische Elite in Deutschland schämte sich der primitiven Verwandtschaft in Galizien, in der Bukowina, in Polen und Russland.
Arthur Koestler lieferte ein meschuggenes Beispiel: Er bewunderte mit Pathos den blonden blauäugigen Muskeljuden, er vergötterte die knallharten Kibbuzim in Erez Israel, und er wollte in seinem Geifer nichts zu tun haben mit den elenden Ostjuden, noch mit den degenerierten Westjuden - seine hysterische Verachtung für seinesgleichen in der Diaspora war zum Lachen, zum Weinen, zum Kotzen. In seiner frühen Lebensphase als konvertierter Kommunist hielt er sich an den Hammer- und Sichel-Satz von Marx: „Wer den Kapitalismus bekämpfen will, muß beim Juden anfangen.“ Genosse Hitler hielt sich an diese orthodox marxistische Reihenfolge. Genosse Stalin umgekehrt: Erst gegen Ende seiner Karriere machte er sich daran, wirklich alle Juden der Sowjetunion auszurotten. Weltgeschichte als ein labyrinthisches Tollhaus!
Es gibt sogar den monströsen Fall eines begeisterten Heil-Hitler-Juden, den Religionsphilosophen und Religionshistoriker Professor Dr. Hans-Joachim Schoeps. Im Februar 1933 gründete der den Verein national gesinnter Juden, dessen Firmenname schon allerhand sagt: „Der deutsche Vortrupp“. In seiner Zeitschrift schrieb er: „Der Nationalsozialismus rettet Deutschland vor dem Untergang: Deutschland erlebt heute seine völkische Erneuerung.“ Professor Schoeps forderte eine „Beschleunigung der unbedingt notwendigen Trennung von deutschen und undeutschen Juden, sowie Erfassung aller deutschbewußten Juden unter einheitlicher autoritärer Führung bei möglichster Umgehung der alten Organisationen.“ Hitler erwiderte dieses Liebeswerben nicht, denn der Führer war ein prinzipienfester Idealist. Hitlers egalitäre Rassenmörder stopften jedes beliebige jüdische Weltgenie und den bettelarmen Milchmann Tewje aus dem Schtetl ohne Unterschied in die gleichen Viehwaggons auf den Weg in die falschen Duschräume und in die echten Verbrennungsöfen. Professor Schoeps rettete sich 1938 nach Schweden, seine Eltern wurden in Theresienstadt und Auschwitz ermordet.
Als ich las, daß mein Freund, der Dichter Günter Kunert, den Theodor Lessing als einen Propheten feiert, kam mir das aufgeblasen vor. Aber jetzt leuchtet es mir ein. In Lessings allerletztem Artikel, der gerade noch in Deutschland gedruckt worden war, finden wir schon das, was die emigrierte Kernphysikerin Lise Meitner erst 1939 exakt berechnete und deshalb auch tiefer durchschaute als Otto Hahn selbst, der seiner Kollegin, noch halb ratlos, von der ersten Kernspaltung im Labor 1938 aus Berlin nach Schweden ins Exil berichtet hatte. Lessing sagte genau das voraus: „In wenigen Jahren wird die Physik gelernt haben, Atome zu spalten. Dann erst kommt die eigentliche Gefahr für das Menschengeschlecht. Denn dann vermögen wir dank den Methoden der Naturwissenschaft endlose dynamische Energien zu gewinnen.“
Und damit landen wir im Jahre 2008 im Perserkrieg unserer Epoche. Diese Atombombe wird ja jetzt vom Mullah-Regime im Iran gebaut. Russland liefert dazu das Know-How, das Material, die Technik. Nordkorea liefert die moderneren interkontinentalen Raketen, China paralysiert im Verein mit den arabischen Staaten den Weltsicherheitsrat der UNO, damit in New York keine wirksamen Sanktionen beschlossen und durchgesetzt werden. Deutsche Firmen tricksen das Waffenembargo aus und liefern auf Umwegen die kleinen feinen Extras.Und die CIA? Sie foppte vor zwei Monaten den Präsidenten der USA mit der Neuigkeit, daß im Iran seit 2003 doch nicht mehr an der Atombombe gebastelt wird. Vier lange Jahre haben die hochqualifizierten Penner des US-Geheimdienstes also gebraucht, um das rauszukriegen. Sogar der weltbekannte israelische Friedensaktivist Jossi Beilin fragte in diesen Tagen besorgt: Wieviel Jahre wird die CIA dann wohl brauchen, um zu merken, daß die iranische Bombe nun leider doch in unterirdischen Fabriken gebaut wird?
Die Welt wird es spätestens merken, wenn das kleine Israel durch eine schiitisch gesegnete Bombe ausgelöscht ist. Die Amerikaner sind so stark und autark und womöglich deshalb keine Genies der Spionage. Im letzten Irakkrieg scheuchte die CIA die GIs der US-Army zum Gespött der globalen Voyeure auf die Suche nach Massenvernichtungswaffen, ABC-Waffen, die Sadam Hussein vorsorglich ins verbündete Syrien in Sicherheit gebracht hatte. Sogar ich Privatmann und Laie weiß, daß die entsprechenden irakischen Fabrikanlagen und Labors, die Techniker und die Wissenschaftler mitsamt deren Familien inzwischen im nationalsozialistischen Reich von Baschar al-Assad leben und ... arbeiten. Ein Kaspertheater mit echtem Menschenblut.
Ja, es ist alles fatal. Die zerfledderten und verhedderten Europäer sitzen hilflos daneben und nerven mit ihrer verlogenen Äquidistanz-Politik.Und die wiedervereinigten Deutschen, sie haben aus ihrem verlorenen Hitler-Krieg nur eine dumpfbackige Lehre gezogen: „Nie wieder Krieg!“ Sie sollten lieber was Neues lernen: Nie wieder eine totalitäre Diktatur! Das käme langfristig günstiger, denn dann kriegen sie den Frieden als Gratisgeschenk dazu. Warum? Weil es bisher noch niemals in der Weltgeschichte einen Krieg gab zwischen zwei Demokratien. Der Historiker Herodot von Halikarnossos schrieb fünfhundert Jahre vor Christus über die Perserkriege: „Niemand wird so dumm sein, daß er Krieg wählt statt Frieden.“
Diese alte Weisheit gilt allerdings nur dann, wenn man die Wahl hat. Und wenn der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad heute den Holocaust leugnet und im gleichen Atemzug Hitlers Werk mit Hilfe der iranischen Atombombe vollenden will, dann müssen die bewaffneten Juden in Israel den Krieg gar nicht mehr groß wählen, denn sie sind schon im Krieg, und das bedeutet: sie müssen ihn führen und gewinnen oder sterben. Der kleine Hitler in Teheran nannte Israel jetzt „eine dreckige schwarze Mikrobe, genannt das zionistische Regime ...“ - ja, er ist ein Dichter. Aber das ist schlechte Poesie, es ist das prosaische Programm der Ausrottung.
Na klar ist Reden besser als Schießen. Den Juden in Israel muß das kein Friedensfreund erklären. Wenn aber alle Peace-Diplomatie und alle Variationen des Appeasements nicht helfen, dann wählt, wer überleben will, den Kampf ums Überleben, sogar dann, wenn es, wie im Warschauer Ghettoaufstand 1943, den eigenen sicheren Tod bedeutet.
Meine Leute in Israel, das sind fünf oder sechs Überlebende der Shoa, Sarah Ehrenhalt und Lydia Vago aus der UNION-Munitionsfabrik in Auschwitz, die Dresdenerin Ruth Adler aus dem Sonder-KZ Vittel, das war Uri Aloni aus Dortmund, Chana aus der Slovakei, das sind Yochanan Zarai aus Ungarn, Naomi Kaplanski aus Polen im Mishkennot-Scha´ananim, ein paar weltberühmte Schriftsteller oder Künstler in TelAviv oder Arad oder Haifa, und vor allem erfahrene Kibbuzniks: altgewordene Jekken in Hazorea, Elisheva, Arnon Tamir aus Stuttgart, Lary El Or aus Wien und die buntegemischte Mischpacha Katzenelson in Sheffayim und die beiden Seneds in Revivim in der Negev-Wüste und nördlich von Haifa die Warschauer Ghettokämpfer im Lochemei Ha´getaot, die weise greise Badana im Ma´ale Ha´chamisha kurz vor Jerusalem - das klingt für deutsche Ohren so exotisch, aber sie alle sind links und kritisch. Meine Freunde dort sind west- oder osteuropäisch, und sie gehörten immer mehr zu den Tauben als zu den Falken im innerisraelischen Streit.
Es gibt aber tragische historische Konflikte, die haben keine Lösung, sondern nur eine wechselvolle Geschichte.Die diversen Tyrannen in den moslemischen Ölstaaten fürchten sich vor ihren eigenen Völkern hundertmal mehr als vor Israel. Schon lange wollten sie alle Juden dort liquidieren. Deshalb vergiften und verblöden sie ihre Untertanen mit einem irrationalen Haß auf dieses kleine blühende Land, deshalb schicken sie die gehirngewaschenen Selbstmordmörder in die Theater, Markthallen, Busse, Bahnhöfe und Schulen. All das ist nichts Neues. Neu ist, daß sie bald die Bombe haben und dann natürlich auch mit blindwütigem Gottvertrauen einsetzen werden.
Reden wir Tacheles: Der Staat Israel ist in seiner politischen und kulturellen Substanz ein europäischer Staat, umgeben von totalitären Todfeinden. Er wäre sogar europäisch, wenn Theodor Herzls Judenstaat vor 6o Jahren auf Madagaskar oder in Birobidshan oder im Amazonasgebiet oder in Alaska gegründet worden wäre: Die Israelis leben in einer westeuropäisch geprägten Kultur, in einer Mischung aus Kibbuz-Sozialismus und kapitalistischer Hightech-Industrie. Ihr Land ist eine Demokratie im permanenten Krieg mit den anti-demokratischen Staaten rundrum, bedroht von theokratischen, nationalsozialistischen oder feudalistischen Diktaturen, die seit Jahrzehnten alle Juden, die rechten, die linken, die araberfreundlichen Tauben, die Falken, die Ashkenasis, die Sepharden ins Meer treiben wollen. Israels Todfeinde sind in diesem Haß fast so idealistisch gesinnt wie es ihr Idol Adolf Hitler war.
Sie lügen nicht, sie tricksen kaum, es ist Verlaß auf sie wie auf Hitler, der in Mein Kampf offen alles sagte, was er denkt. Und als er 1933 an die Macht gekommen war, tat er es auch. Gegen Ende des Krieges, 1944/45, hatten bei der Bereitstellung von Eisenbahnwaggons der Reichsbahn die Judentransporte Priorität vor dem Nachschub für die Wehrmacht. Der Titan des Völkermords Hitler kämpfte verbissener um die Endlösung als um den Endsieg. Heute sind es diese religionskriegerisch ideologisierten Todfeinde Israels, die ohne Rücksicht auf eigene Verluste die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten vernichten wollen. Auslöschen wollen diese Finsterlinge das verführerische Licht einer modernen Wirtschaft, einer beneidenswerten Natur-Wissenschaft, einer aufreizend lebendigen Literatur.
Und wir? Nicht aus heißer Scham und schlechtem Gewissen über die Schande der Shoa - nein, aus kühlem Eigeninteresse sollten wir uns die Pose einer gutmenschelnden Äquidistanz in diesem Dauerkrieg nicht leisten. In dem uralten und unlösbaren Konflikt zwischen den verfeindeten Brüdern Ismael und Isaak müssen wir Partei ergreifen für das demokratische Israel. Und alles, was die Deutschen im Sinne der Menschenrechte damit langfristig auch für das Aufblühen einer moslemisch geprägten Freiheit tun, beruhigt mein Herz.
Die EU hat jetzt Rumänien und Bulgarien als Mitglieder aufgenommen. Albanien und Georgien und die Türkei und Weißrußland wollen in die EU - alles Länder, die uns noch lange fremder sein werden als Israel heute. Vielleicht bin ich ein Träumer - aber sollte nur meine kleine Tochter Mollie träumen dürfen, und darf etwa nur Martin Luther King „a dream“ haben? Wenn überhaupt noch ein Land, ein Staat, ein Volk, ein Wirtschaftsgebiet, dann gehört Israel gleich Griechenland und Italien in die EU. Ich wünsche mir in Berlin sturtapfere Politiker wie einst Winston Churchill. 1940 stand er zu Polen, als Hitler und Stalin sich die Beute brüderlich teilten, es lohnt sich, seine berühmteste Rede „Blood, Sweat and Tears“ vom 13. Mai 1940 mal wieder zu lesen.
Auch ich geborenes Kommunistenkind mußte es lernen: Ja besser! gerechter! menschlicher! soll die Welt werden, und aus diesem ewigen Freiheitskrieg bin ich niemals desertiert. Jedes kommunistische Paradies auf Erden hat sich aber als eine rotgetünchte Hölle erwiesen. Und es gibt leider auch nicht den Weg des Immanuel Kant „Zum ewigen Frieden“ durch völkerrechtlich ausgehandelte Verträge. Ach! und Freiheit tut eben weh. Demokratie ist unbequem, anstrengend, gefährlich. Freiheit bedeutet nichts anderes als Verantwortung tragen für sich selbst und für die Gattung Mensch.Ich sehe in diesem heillosen Nahostkonflikt ein Lehrstück für die Welt. Nicht nur Israels Existenz ist da bedroht ... das Volk der Juden in seinem winzigen Land kommt mir auserwählt vor, ja, aber nur im katastrophalen Sinn. Israels Schicksal sehe ich als ein Menetekel für die Völkerfamilie auf diesem winzigen Planeten Erde. Europa und die USA nehmen ab, und China, Indien, Afrika, Lateinamerika nehmen zu an Gewicht und treten ein ins globale Spiel. Der Nahostkonflikt kommt mir vor wie ein Lehrstück für kommende Kämpfe.
Als Voltaires Romanheld Candide, als ein edler Naivling also, hat der Mensch keine Zukunft. Nur brav unseren Garten zu bestellen, das wird uns nicht retten. Ich sehe für die Menschheit eine Überlebenschance: Es muß sich hier auf Erden nur und sehr bald herumsprechen, daß die unvollkommenste Demokratie besser ist als die vollkommenste Diktatur.
Comeback eines toten Hundes
Wolf Biermann über die Wiederbelebung des Begriffs "Demokratischer Sozialismus" durch Kurt Beck
Ich find´s komisch. Nein: traurig! Nein: lächerlich! Der SPD-Funktionär Kurt Beck holte nun in höchster Not aus der politischen Mottenkiste das verdorbene Schlagwort „Demokratischer Sozialismus“. Will er, wie Lafontaine, in die PDS überlaufen? Wohl kaum. Die PDS ist doch die Partei mit dieser verluderten Phrase im Firmenschild. Will er etwa den linken Etikettenschwindel linkisch überschwindeln? Wo geht´s lang mit der SPD? Vorwärts! - nach hinten? Oder Aufwärts! - nach unten? Armer Beck! Wo könnte ich diesem barocken Unglücksmenschen begegnen? Auf der Barrikade? Nein! Im Konzert? Wohl kaum! Womöglich in der Maske-Abteilung irgendeines Fernsehstudios kurz vor der Sendung, wo der Politiker Beck für eine Talk-Show und der Mietkünstler Biermann für ein paar Lieder vor der Kamera geschminkt werden. Leichtes Make-Up über die geröteten Wangen.
Ja, so trifft man sich vielleicht. Säße er jetzt am Schminktisch neben mir, würde ich ihn von der Seite anquatschen und ein bißchen verwirren mit diesen irren Worten: „Heil Hitler, Genosse! Der Nationalsozialismus - ja, das ist ... der nationale Weg ... zum Sozialismus, ... eben der deutsche! Und also darf Adolf Hitler nicht länger unser Feind sein. Hitler ist ein Sozialist, ist unser Genosse im Kampf um den Sieg der Weltrevolution. Die NSDAP ist doch eine National-Sozialistische-Arbeiter-Partei und also der natürliche Verbündete der Kommunisten im Kampf um den Sozialismus in Deutschland ... ! - Wir Sozis und Kommunisten sind doch im Grunde auch zutiefst national. Und die Genossen in Moskau haben das begriffen, der Genosse Stalin denkt auch so. Ernst Thälmann hat ja deswegen den „National-Kommunismus“ begründet. Ich bin sicher, daß Thälmann jetzt frei wieder kommt, Stalin läßt jetzt an Hitlers Seite seinen alten Genossen doch nicht im Stich...“
Und dann würde ich dem irritierten Kurt Beck die Wahrheit sagen: Solche irren Reden schwang 1939 der große Romancier Dänemarks, Martin Andersen Nexø, als er grade begeistert von einer revolutionstouristischen Reise aus Moskau zurück gekommen war.
Brechts dänische Mitarbeiterin Ruth Berlau hat es mir dreißig Jahre später in der Chausseetraße 131 unter Tränen berichtet. Ja, solchen gespenstischen Irrsinn redete Nexø dem armen B.B. ein, als er den deutschen Dichter und dessen Frau Helene Weigel und Brechts Kebsweiber Berlau und Margarethe Steffin unterm dänischen Strohdach in Svendborg besuchte. Nexø verkündigte linientreu die neueste Wendung der Komintern-Strategie, nach dem Abschluß des Paktes zwischen Hitler und Stalin. Durch solch eine schreckliche Geisterbahn fährt mein Kinderherz, wenn nun die Propaganda-Parole „Demokratischer Sozialismus“ von Kurt Becks SPD in dem panischen Klassenkrampf um deutsche Wählerstimmen wieder verwendet wird. Das Bibelwort des Weisen Salomo „Alles hat seine Zeit ...“ gilt auch für die politischen Schlagworte des Zeitgeistes. Aufklärung - Demokratie - Sozialismus - Kommunismus. Kein Mensch hält ewig, einige halten etwas länger, schrieb Brecht. Das gilt auch für die Ideen im Geschichtsprozess.
Es war übrigens Heinrich Heine, der Poet im Exil. Heine transportierte als Pariser Korrespondent über Cottas Augsburger Allgemeine Zeitung als Allererster in den 30er Jahren das tolle Modewort „Communisme“ nach Deutschland, immerhin etliche Jahre vor Marxens Manifest der Kommunistischen Partei. Sozialismus als kurze Vorstufe zum Kommunismus! Von dieser neuesten Utopie schwärmten damals die besten Köpfe: Klassenlose Gesellschaft! kein Privateigentum an Produktionsmitteln! keine Ausbeutung mehr! keine Unterdrückung! kein Staat! keine Heuchelei! keine Kriege! kein Reichtum und keine Armut! alle Menschen werden Brüder! Ja, damals bedeutete die Parole Kommunismus die praktische Verwirklichung der französischen Dreifaltigkeit: Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit.
Manchen mag es interessieren, daß die ursprüngliche Losung der Französischen Revolution nur ein flotter Zweibeiner war: „Freiheit und Gleichheit“. Zeitgenosse Geheimrat Goethe roch gleich den Braten mit der Gleichheit in Freiheit. Er mokierte sich im feudalen Weimar scharfsinnig über die innere Unlogik dieses Begriffs-Paares: „Gesetzgeber oder Revolutionärs, die Gleichsein und Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten oder Charlatans.“ Und weil dieser logische Einwand bald auch den Revolutionären in den Sinn kam, erfanden sie ein dialektisches Bindeglied zwischen den Antipoden Freiheit und Gleichheit, sie fügten als drittes Element die „Brüderlichkeit“ hinzu. Im heutigen Jargon: Solidarität. Ja, eine aufgeklärte Nächstenliebe sollte das Dilemma auflösen.
Heute aber sage ich mit der billigen Klugheit des Nachgeborenen: Ich kann - leider! - kein Kommunist mehr sein, denn Kommunismus bedeutet böse verdeutscht: die Endlösung der sozialen Frage. Und trotzalledem liebe ich Heines noch unschuldige Verse: „Ein neues Lied, ein bessres Lied, o Freunde will ich euch dichten/ Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten.“Hundertfünfzig Jahre später wissen wir: Wer das Himmelreich auf die Erde zwingen will, der landet in der totalitären Hölle. Gott läßt sich nicht hinter die Kulissen des himmlischen Paradieses gucken, deshalb lebt auf Erden der Glaube. Aber die Hoffnung auf den Kommunismus ist tot.
Und genau so wie die Utopie „Kommunismus“ ist der Slogan „Demokratischer Sozialismus“ ein geschichtlich gewachsener Begriff. Er entstand im Streit der Sozialdemokraten gegen Lenins totalitäre Doktrin. Die „Diktatur des Proletariats“ erwies sich als eine Diktatur der Partei und dann sehr bald als die Diktatur einer Handvoll Parteiführer über die Partei. Auch der Slogan „Demokratischer Sozialismus“ hat sein historisches Verfallsdatum schon lange überschritten. Und war zudem von Anfang an ein weißer Schimmel. In den Anfängen der Arbeiterbewegung gab es diese doppeltgemoppelte Begriffskombination noch gar nicht, weil Demokratie und Sozialismus ursprünglich wie Synonyme verstanden wurden. Ein „Demokratischer Sozialismus“ wäre den Zeitgenossen von Marx, Engels, Lassalle und Bebel und Liebknecht und vor allem Rosa Luxemburg tautologisch vorgekommen.
Im Godesberger Programm der SPD 1959 wurden die Begriffe „Sozialdemokratie“ und „Demokratischer Sozialismus“ von den Partei-Ideologen als gleichbedeutend verwendet. Und als der neu gewählte Parteisekretär der KP in der CSSR, Alexander Dubcek zusammen mit seinem Staatspräsident Svoboda (auf Deutsch: Freiheit) im Jahre 1968 den Prager Frühling wagte, da versuchten die Tschechen und Slovaken aus dem sowjetischen Lager auszubrechen auch mit dem Heilsversprechen „Demokratischer Sozialismus“. Plötzlich blühte diese blöde Wortkombination hoffnungsheilig auf. Im totalitären Regime sollte dieses Doppelwort ein zauberstarkes Schutzschild gegen den Vorwurf der Konterrevolution sein. Wir nannten diese sozialdemokratische Tendenz im poststalinistischen Ostblock auch poetisch: „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Dieser Pleonasmus sollte den Apparatschiks der KP signalisieren: Wir sind doch für den Sozialismus!! und dem geprügelten Volk sollte er versprechen: Wir werfen den alten Knüppel weg, wir haben ein menschliches Antlitz!!
Kommunistische Dissidenten wie Robert Havemann und ich, wohl alle unsere engeren Freunde in der DDR hätten damals jeden Wisch unterschrieben, auf dem „Demokratischer Sozialismus“ stand. Aber der Einmarsch der fünf Warschauer-Pakt-Armeen am 21. August war der Anfang vom Ende auch dieser Illusionen. Genau so wie „Kommunismus“ ist auch das Wort „Sozialismus“ ein Synonym für Unfreiheit geworden, für Menschenverachtung und Mißwirtschaft. Was Begriffe und Slogans und Schlagworte bedeuten, wird eben nicht in Seminaren und in ideologischen Kommissionen entschieden, sondern im wirklichen Geschichtsprozess. Nationalsozialismus - das hat sich inzwischen rumgesprochen - heißt in klares Deutsch übersetzt nicht Autobahnen und nicht Familienfreundlichkeit und nicht „Kraft durch Freude“, sondern Eroberungskriege, Völkermord, Gaskammern für die ganze Familie, heißt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, blutiger Stumpfsinn. Und das Wort „Kommunismus“ bedeutet heute: sowjetisches GULag , totalitäres Massenelend, idiotische Planwirtschaft oder turbo-chinesischer KZ-Kapitalismus, oder nordkoreanische Verelendung und kubanischer Personenkult.
Und das Wort „Sozialismus“ heißt seit dem totalitären Tierversuch an lebendigen Menschen nur noch: systematische Indoktrination, Erziehungsdiktatur, Folter, Willkür, Okkupation, Spitzelstaat, Maulkorb, Rechtlosigkeit.Und in diesem Ideenkuddelmuddel greift Kurt Beck in der Not nach dem verwüsteten Wort. Karl Marx, von dem wir wissen, daß er ganz sicher kein Marxist war, würde über die neueste SPD-Volte spotten: „Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ - Und genau solch eine Farce erleben wir in diesen Tagen mit dem Kasperletheater „Demokratischer Sozialismus“. Das Krokodil Kurt Beck spielt den Kasper und der Kasper Franz Müntefering spielt das Krokodil. Das Ganze ist eine Posse, ein dumpfbackiges Lustspiel ohne Lust.
Wohl wahr, die SPD hat eine panische Angst vor den Erben der SED-Nomenklatura, die sich Partei des demokratischen Sozialismus nennen, obwohl die drei Buchstaben PDS doch bedeuten „Partei Der Spitzel“. Gysi und Bisky und Lafontaine spielen längst die Klamotte „Demokratischer Sozialismus“ für die alten DDR-Kader und für die links-alter-na-iven Kids im Wiedervereinigten Deutschland.
Als Prophet konnte ich noch nie das Salz in die Suppe verdienen. Ich weiß also nicht, was daraus wird. Ich denke an die tapferen Sozialdemokraten im Kampf gegen die Nazis. Ich denke mit Kummer an die namenlosen SPD-Genossen, die nach 1945 von den sowjetischen und deutschen Stalinisten massenhaft liquidiert wurden. Die SPD hatte in ihrer Geschichte nie Glamour, eher eine solide Graue-Maus-Tradition. Aber sie wurde geprägt von so tapferen Menschen wie Ernst Schumacher und Erich Ollenhauer, von dem faszinierenden Willy Brandt und dem weltklugen Helmut Schmidt. Die PDS hat dagegen eine Tradition mit solchen Apparatschiks wie Stalin, Ulbricht, Erich Mielke, Markus Wolf, Honecker, Krenz, Gysi und Bisky.
Sollen die doch - würde ich dem nun fertig geschminkten Kurt Beck schnell noch vor der Sendung sagen - sollen doch Lafontaine & Co. den toten Hund „Demokratischer Sozialismus“ durch Mund-zu-Mund-Beatmung ablecken. Aber Sie? Ich find´s tragisch. Bitte! Kurt Beck, lassen Sie das!
Rede im Roten Rathaus
am 26. März 2007 zur Verleihung der 115. Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin
Anfang der 70er Jahre besuchte mich in meiner Wohnung Chausseestraße 131 ein Westjournalist und sagte: „Immer Robert Havemann und Wolf Biermann, immer nur Biermann und Havemann. Gibt es sonst keine Opposition im Osten? - Ich sagte: Das ist eine optische Täuschung, sowas passiert nur Ihnen aus westlicher Perspektive. Die Opposition der DDR ist in Wahrheit ein Tausendfüßler. Wenn sie den aber ganz genau von vorn anschaun, dann sehn Sie vom Tausendfüßler eben nur dessen zwei Vorderbeine.
Meine Dankrede ist also - salopp gesagt - den 998 Beinen gewidmet. Und deshalb haben die viel zu vielen Namen, wenn ich sie jetzt nennen werde, nichts von dem, was unser Philosoph Hegel so nennt: Die schlechte Unendlichkeit. Nach dreißig Jahren hat sich für mich ein Kreis geschlossen. Im November 1976 überlebte ich die Ausbürgerung, und nun, im wiedervereinigten Berlin, erlebe ich eine Art Wiedereinbürgerung. Ja, meine Ausbürgerung erschien mir damals wie ein Sterben, doch sie erwies sich bald für mich als eine Renaissance, ich wurde endlich, mit vierzig Jahren ein Weltenkind.
Die Maulschlacht um diese 115. Ehrenbürgerschaft ist nun geschlagen. Mich hat das parteipolitische Possenspiel vor und hinter den Kulissen halb amüsiert und halb gekränkt. Das sei zugegeben: Auch ich werde lieber geehrt als diffamiert, werde lieber gelobt als getadelt, lieber gestreichelt als geschlagen - fragt sich allerdings immer wieder: von wem! und wann! und warum!
Unter uns, Herr Regierender Bürgermeister Wowereit: mich hat der schrille Parteienstreit hier mehr beruhigt als geärgert. Es bestärkt einen, wenn man sich seiner treuen Freunde und seiner treuen Feinde immer mal wieder vergewissern kann.
Also genieße ich diese Ehrenbürgerschaft erstmal arglos wie einen Kuß der Stadt Berlin in meine Seele.
Ich schaute mir zu Hause in Altona die komplette Liste der 114 Berliner Ehrenbürger an und erkannte in diesem historischen Bilderbogen eine sympathische Tendenz in Richtung zivile Bürgergesellschaft. Im blutigen 20. Jahrhundert hat sich endlich die demokratische Traditionslinie Max Liebermann, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Anna Seghers, Helmut Schmidt, Michail Gorbatschow, Marlene Dietrich und Heinz Berggruen durchgesetzt gegen dubiose Ehrenbürger Berlins aus den beiden deutschen Diktaturen. Dick durchgestrichen sind also solche Namen wie Hitler, Goebbels, Göring, Ulbricht und Honecker.
Wieviel nun die Stadt Berlin ausgerechnet ihrem 115. Ehrenbürger verdankt, wissen andere besser als ich. Und wüßte ich es, wäre ich nicht so blauäugig, es offen zu sagen. Was allerdings nicht die Stadt Berlin mir, sondern was umgekehrt: ich der Stadt verdanke, das weiß ich wohl und will es auch freimütig bekennen: Ich verdanke Berlin nicht viel ... , sondern fast alles. Nur hier konnte ich der werden, der meiner Mutter einziger Sohn Karl-Wolf in seiner Vaterstadt Hamburg gar nicht hatte werden wollen: Der Biermann.
Gitarre spielte ich schon als Schüler im Westen. Auf den Kopf oder auf den Mund oder gar auf die Knie gefallen war ich nie. Aber nur in Ostberlin konnte ich wohl auf die unbescheidene Idee kommen, Verse zu schreiben und Lieder zu komponieren. In Ostberlin geriet ich Mitte der fünfziger Jahre in den Sog des Brechttheaters. Dort durfte ich am Berliner Ensemble als Regieassistent bei Benno Besson und Erich Engel lernen. In Berlin hatte ich die Chance, bei Wolfgang Heise Philosophie zu studieren und konnte gleichzeitig, auch aus Gründen der geistigen Hygiene, ein Mathematikstudium an der Humboldt-Universität absolvieren.
In Berlin-Niederschönhausen traf ich Glückskind meinen Mentor Hanns Eisler, fand im richtigen Moment, als der Streit immer ernster wurde, meinen todesmutigen Freund Robert Havemann, ohne den ich die zwölf bedrückenden Jahre des totalen Verbots nicht so heil durchgestanden hätte. So wuchs ich auf der Bühne des Welttheaters rein in die Rolle des kleinen Drachentöters mit dem klingenden Holzschwert. Aber solch ein todernstes Spiel gelingt nur, wenn da erstens ein echter Drache ist, wenn einem zweitens genügend Tote den Rücken stärken, lebendige Tote wie mein Vater, der Kommunist Dagobert Biermann und die zwanzig Toten meiner jüdische Familie, die 1941 in Minsk von der SS in die Grube geschossen wurden ...
Und eine Chance im Streit der Welt hat nur, wer drittens auch noch genügend lebendige Verbündete findet. Solchen Gefährten wie dem liberalen Kommunisten Robert Havemann und seiner Tochter Bylle und seiner Frau Katja, solchen tapferen Freunden wie dem jungen Schriftsteller Jürgen Fuchs und dem urberliner Schlosser Horst Mölke und solchen Künstlern wie Lothar Reher und Horst Hussel und Sabina Grzimmek verdankte ich meine Ausdauer. Mein Freund Jürgen Böttcher, der geniale Dokumentarfilmer und Maler hielt tapfer zu mir in all den schweren Jahren. Wenn seine Genossen ihm wegen unserer Freundschaft mit Hammer und Sichel drohten, verteidigte er sich so: „Genossen, ihr habt ja Recht, aber ich kann nichts machen, wir sind befreundet.“
Umgürtet wie mit einem Schutzpanzer war ich im Krieg gegen die falschen Kommunisten von so echten Ur-Christen wie Ekke Maaß im Prenzlauer Berg. Oder solche Freunde wie der BE-Doktor Tsouloukidse am Schiffbauerdamm oder wie der hochgebildete Kohlenträger Noack aus der Invalidenstraße, der mir die Briketts raufschleppte für meinen Kachelofen.
Ohne die DDR-Jazzer Uli Gumpert und Baby Sommer und Luten Petrowski und Uschi Brüning und Conny Körner, ohne den Dichter Günter Kunert und ohne Jurek Becker, den wahrhaftigsten Lügner, ohne solche Ostwortler wie Volker Braun und Sarah Kirsch und Helga Novak und Reiner Kunze und Stefan Heym und Heiner Müller und ohne so Westwortler wie Böll, Wagenbach, Peter Schneider, Peter Weiß, ohne Wolfgang Neuss, der weißgott mehr konnte, als nur auf die Pauke haun, ohne den Radikalträumer Rudi Dutschke, ohne Cantautore Daniel Viglietti und ohne den Beat-Poeten Allen Ginsberg und die Erzengelin Joan Baez, die mich Outcast in meiner Ostberliner Höhle besuchten und ohne so unverwüstliche Selbsthelfer wie Manne Krug und ohne den Malpoeten und lebenslänglichen Lastkraftwagenfahrer Peter Graf in Dresden und ohne den selbstlosen Mut der Bildenden Hungerkünstler von Ückeritz:
Otto und Oskar Manigk und Matthias Wegehaupt, Susanne Kandt-Horn und ohne die fromme Freundefresserin Ricarda Horn und ohne den plietschen Niemeyer-Holstein auf Usedom - geschweige denn ohne Eva-Maria Hagen und Matti Geschonnek und ohne Birgit Frohriep, die sich schmerzhaft von der Leine des MfS losriß, Ohne den Drainageleger Freddy Rohsmeisel und den Heizungsmonteuer Werner Fuhr und ohne den widersprenstigen Kunstspringer „Pofi“ Pophal und ohne den Drehleiermacher Zölch und die Gitarrenbauer Max Hoyer und Claus Voigt und Meinel A. in Markneukirchen und ohne den krummgeackerten, aber ungebrochen sozialistischen Anti-LPG-Bauern „Dokting“ Fick in Mecklenburg und ohne die beiden übriggebliebenen Judenkinder aus dem GULag Ilja und Vera Moser, ohne die glutherzige Barbara Honigmann, die mir ein goldenes Wort schenkte („Ach Wolf, die lachen wir von jetzt ab alle an die Wand!“) und ohne den tollpatschigen Sonderling, der meine sämtlichen Tagebücher jahrelang im Dorf Brodowin an der Oder versteckt und alle gerettet hat, also ohne Reimar Gilsenbach ... gäbe es den Biermann gar nicht.
Ohne die Bäckersleute Erwin und Emmchen Liebig, die mich im August und September 1968 in Friedrichshagen am Müggelsee versteckten, ohne die wunderbar unwürdige Greisin Charlotte Pauly, ohne meinen Nachbarn in der Chausseestraßenwohnung, den großen Brechtschauspieler Martin Flörchinger und ohne Tine Rosine Biermann wäre ich verloren gewesen, wäre verzagt, verbittert, verblödet, verstummt und vergessen. Jeder Name in dieser viel zu langen und dennoch viel zu kurzen Liste ist ein Roman für mich oder eine Novelle oder eine Ballade, die ich niemals werde schreiben können. All diese Namen lasse ich nun wie Perlen durch meine Finger gleiten, sie sind mein Rosenkranz, wenn ich frommer Atheist zu Gottes Schöpfer bete, zum Menschen. Ja, Namen Namen Namen. Das soll bedeuten: Nicht nur die gemeinen Zustände entscheiden unser Schicksal - immer sind es auch die lebendigen Einzelnen. Und diese Lektion lernte ich schon von meiner Oma Meume und von meiner starken Mama in der Nazizeit.
Wir fanden allein in meinen Stasi-Akten bis heute über zweihundert IMs, die sich um mich kümmerten, dazu diverse höhere MfS-Führungsoffiziere wie etwa Lohr und Reuter. Na und?! Das hört sich für den naiven Betrachter gewaltig an. Aber solche Zahlen locken in eine Falle. Die Deutschen sollten in der Stasidebatte gelegentlich durchschauen und bedenken, daß die Zahl der so genannten Guten und Tapferen und der stillen Helden in den finsteren Zeiten der zweiten deutschen Diktatur noch viel viel größer ist. Und genau das dokumentieren meine Akten in der Birthler-Behörde.
Ich errechnete mal, daß die Firma der Generäle Mielke und Markus Wolf zwanzig mal mehr Mitarbeiter pro Kopf der Bevölkerung beschäftigte als in der Nazizeit die Gestapo. Und das spricht nicht etwa gegen die so genannten Ossis, sondern im Gegenteil! es beweist, daß es in der DDR entsprechend viel mehr Widerstand gab, der von den Herrschenden niedergehalten werden mußte, mehr als etwa in Nazideutschland. Um die leider viel zu wenigen Widerständler im begeisterten Heil-Hitler-Volk in Schach zu halten, brauchte es eben nicht ganz so viele Schergen und Spitzel.
Also zähle ich dermaßen maßlos viele Namen meiner Freunde auf, mit Zorn und Stolz und Dankbarkeit. Denn diesen Menschen verdanke ich es, daß ich in der Tradition von Heinrich Heines Gedicht „Enfant Perdu“ ein ostberliner Soldat im ewigen Freiheitskrieg der Menschheit wurde, der heute mit der Lobrede eines demokratisch gewählten Bürgermeisters ausgezeichnet wird.
Nur mit Hilfe dieser Berühmten und all der Namenlosen konnte ich in der Tradition von François Villon und Victor Hugo ein Gavroche Allemand werden. Nur so konnte ich in meiner Wohnung Chausseestraße 131 all die Gedichte schreiben über Berliner Liebespaare, hin- und hergerissen in großer politisch Landschaft, dort reimte ich solche zille-berlinischen Pasquille wie im Jahre 1965 die Populär-Ballade mit den Spottversen über die verdorbenen Greise im ostberliner Politbüro:
Im Neuen Deutschland finde ich
Tagtäglich eure Fressen
Und trotzdem seid ihr morgen schon
Verdorben und vergessen!
Heut sitzt ihr noch im fetten Speck
Als dicke deutsche Maden
-ich konservier Euch als Insekt
Im Bernstein der Balladen!
Als Bernsteinmedaillon, als Ring
Als Brosche auf dem Kragen,
So werden euch die schönen Fraun
Im Kommunismus tragen ...
Im zweiten Stock an der Ecke Chausseestraße-Hannoversche gegenüber der Ständigen Vertretung der BRD sang ich meinen Besuchern aus Ost und West die verbotenen Lieder vor und attackierte damit nicht nur unsere Herrschenden, sondern mehr noch sang ich an gegen unsere lähmende Angst vor dem übermächtigen Machtapparat.
Und es konnte mir auch nur in Berlin passieren, daß ausgerechnet dort auf der Weidendammer Brücke über der Spree dem preußischen Ikarus dann die Flügel aus Gußeisen anwuchsen. Diese Ballade vom Preußischen Ikarus erwies sich im Kölner Konzert am 13. November 1976 als eine ahnungsvolle Metapher für den Absturz auf dem Flug von Ost nach West in das deutsch-deutsche Exil.
Ich las dieser Tage rum in meinen vielen Versen über Berlin und bestaunte mit einem stillen Lachen, daß ausgerechnet ich, der plattdeutsche Fischkopf aus Hamburg, nicht im naiven, sondern im sentimentalischen Sinne ein Berliner Heimatdichter geworden bin. Und wie in jeder lebenslangen Liebesaffaire gab es verschiedene Phasen, viel Auf und Ab und Auf.
Ein Jahr vor dem Prager Frühling schrieb ich mir ein kleines Lied, nur acht Zeilen lang, mit dem ich es mal wieder schaffte, mich zwischen alle deutschen Stühle zu setzen. Und das gelang mir nur so perfekt, weil ich es gar nicht gewollt hatte.
Es senkt das deutsche Dunkel
Sich über mein Gemüt
Es dunkelt übermächtig
In meinem Lied
Das kommt, weil ich mein Deutschland
So tief zerrissen seh
Ich lieg in der besseren Hälfte
Und habe doppelt weh.
Viele Westler reagierten wütend, weil ich die schäbige DDR mit solcher Chuzpe die bessere Hälfte nannte. Und im Osten rasten die Herrschenden der DDR vor Wut, weil da ein junger Lyriker klagte, er leide in der größten und schönsten DDR der Welt ein „doppeltes Weh“. Und einen gesamtdeutschen Wutanfall gab es auch: manche antifaschistischen Literaten in Ost und West hat es angewidert, daß „nach all dem!“ ein Linker mit rechter Innigkeit plärrt: „Das kommt, weil ich mein Deutschland so tief zerrissen seh.“
Die folgende Berlin-Ballade berichtet von einem verrückten Standard-Albtraum, den damals viele Menschen in Ostberlin hinter der Mauer träumten - jeder natürlich in seiner eigenen unverwechselbaren Variante, aber im Grunde doch jedesmal die gleiche extrem unrealistische Konstruktion: Im Traum also schlüpfte, rannte, schwebte man kinderleicht durch Stacheldraht und Minenfeld und geharkten Todesstreifen und Hundelaufgraben und über die Betonröhre rüber nach Westberlin, aber dann schaffte man es nur quälend schwer oder gar nicht wieder zurück.
BALLADE VOM TRAUM
1
Der Möbelwagen schwimmt die leere Friedrichstraße lang
Und landet vor dem Haus, ja ja, ich weiß: der will zu mir
Schrein kann ich nicht. Die Schritte kommen, und ich kenn den Gang
Da klotzen schon die vier knallharten Packer in die Tür
Und schaffen mich im Bett die Treppen runter: immer vier
Vier Mann - vier Ecken. Und verfrachten mich im Laderaum
Dann das Klavier. Der Kleiderschrank. Die Bücher. Gummibaum
Die Schreibmaschine. Alle acht Gitarren gut verstaut
Dann heult der Diesel auf, die Wagentür wird zugehaun
- das ist mein Traum,
vor dem mir jeden Abend graut
2
Der volle Möbelwagen-Walfisch schwimmt mit mir im Bauch
Das Stück Hannoversche. Die Charité wird rechts passiert
Links Invalidenstraße durch den Schlagbaum. Slalomschlauch
Wir schwimmen durch die Grenze, und der Staatsrat salutiert
Spalier steht das Politbüro, die Knarre präsentiert
Schon sind wir durch und drüben. Mensch, wie leicht geht das!
Da winkt auch schon ein Strand: der Ku'damm schillert regennaß
Der Fisch spuckt mich mitsamt den Möbeln auf den Asphalt, halb verdaut
Macht eine Wende, schwimmt zurück. Ich such wie wild mein' Paß
- das ist mein Traum,
vor dem mir jeden Abend graut
3
Der westberliner Himmel schluchzt und weint sich auf mir aus
Ich krabbel aus dem Müll und renn mit festgewachsnen Schuhn
Zurück, woher ich kam und will will will und will nach Haus
Die Mauer flatter ich entlang wie ein besoffnes Huhn
Und reiß ein Loch und beiß mich durch den Stacheldraht.
Und nun Zerreißen Schüsse meinen Bauch. Der deutsche Schäferhund
Verschlingt König Renauds Gedärme, die sind seltsam bunt
Und dampfen. Roter Saft fällt komisch aus der tauben Haut Und Regen regnet in den starren himmeloffnen Mund - das ist mein Traum, vor dem mir jeden Abend graut
4
Dann wach ich auf, von Schweiß und Tränen klitschenaß
Mein Weib weint trocken mit und streichelt mich
Sie weiß es ja - und doch, sie fragt dann:
Was Was hast du, Lieber, laß den schwarzen Traum, dreh dich
Mal um zu mir! na siehste, du bist schon o.k. - oh je!
Du hast die Nacht zu gut gegessen und zu schwer verdaut
- und darum träumst du auch
den Traum, vor dem mir graut.
Nach meiner Ausbürgerung absolvierte ich jedes Jahr Konzerte in Westberlin, aber ich flog immer so schnell wie möglich zurück nach Hamburg. Ich wollte nicht auf die Mauer starren, hinter der meine unerreichbaren alten Freunde festsaßen. Direkt nach dem Zusammenbruch der DDR aber wollte ich nix wie zurück, wollte wieder mit Kind und Kegel in Ostberlin leben. Das mißlang mir schmerzhaft - und auf eine für mich lehrreiche Weise.
Immerhin, acht Jahre danach, lebte ich mit meiner Familie wenigstens ein pralles Jahr lang 1997/1998 als Gast, als Fellow am Wissenschaftskolleg nahe dem Grunewald. Ich hatte dort eigentlich in Ruhe meine Shakespeare-Sonette ins Deutsche bringen wollen und wollte nebenbei mit solchen Koryphäen wie Wolf Lepenies und Peter Wapnewski und Wolfgang Mommsen und Karl Corino und Rabbi Albert Friedlander aus London und dem jüdischen Arabisten Gabi Warburg aus Haifa in Ruhe alle Probleme der Menschheit endgültig lösen. Aber auch diese Plane erwiesen sich als unrealistisch. Das rabiate Berlin zottelte und knuffte und streichelte mich und grapschte mir ans Herz: Massive Morddrohungen und politische Liebesanfälle. Also schrieb ich lieber neue Gedichte und Lieder - und nun zum ersten mal auch über den Westen der Stadt. Verse über die Potse und den Landwehrkanal, über den Wald aus Baukränen am Potsdamer Platz und über Moabit. Und der Güterbahnhof Grunewald: An der Rampe an den Gleisen dort, wo die Berliner Juden in die verschiedenen Todeslager transportiert wurden, lief ich mit Heinz Berggruen entlang. Wie zwei spielende Greise, die grade neu das Lesen lernen, so buchstabierten wir die Lettern in Stahl gegossen, die lange lange Liste der einzelnen Transporte mit Datum, Zielort und genauer Mengenangabe. - 17. August 1942 - Theresienstadt - 1002.
Der Angelus novus berliniensis blickt zurück, aber nicht ins Paradies, sondern in die Höllen der Hitlerzeit. Die fröhlichen Kids aufm Kollwitzplatz. Olle Knutsch-Ede im Ruderkahn mit seine mollige Jette uffm Wannsee. Und Kohlen-Otto im berühmten „116“ inner Friedrichstraße - allet schön bunt durchnander, wie int richtje Leebn. Und schon wegn diese Jedichte darf ick jetz kess behauptn: Ick bin een Baliner ... Stadtschreiber. All meine neuen Kiez-Gedichte nannte ich „Paradies uff Erden - ein Berliner Bilderbogen“.
Letztes Jahr schrieb ich mir ein Berlin-Gedicht, das ich bei anderer Gelegenheit lieber singen würde. Ihnen hier lese ich es vor, es hat den Titel „Heimkehr nach Berlin Mitte“.
Die Situation der Heimkehr nicht nur aus der Fremde ... , sondern vor allem: Heimkehr in die Fremde ... ist alt wie die Menschheit. So passiert es den Heimkehrern fast immer: Wer von großer Reise nach langer Zeit zurückkommt, aus dem Krieg wie etwa Odysseus, oder aus dem KZ oder aus dem GULag oder aus dem Exil, der macht die Erfahrung, daß er nicht mehr dazu gehört. Die Leute haben sich verändert. Die alten Kumpel sind in alle Winde verweht, die Verhältnisse sind gekippt, vertraute Worte bedeuten nicht mehr dasselbe, und die Seelenökonomie funktioniert nach neuen Spielregeln. Aber vor allem: Man selbst ist nicht mehr derselbe. Und so kommst du eben nach Hause als ein Fremdling.
Ein raffiniert diffuses Wort dazu prägte der Dichter Rimbaud. In einem Brief an seinen Lehrer Paul Demeny schrieb der junge poète maudit im Jahre der Commune de Paris 1871 den Satz in richtig falschem Französisch: Je est un autre... Aber genau so herzzerreißend habe ich es nach der Wende auch erfahren, diesmal in Ostberlin: Nicht: je suis .. ich bin, sondern wie eine Kirsche ohne Kern: Je est ... Ich ist ein anderer.
HEIMKEHR NACH BERLIN MITTE
»Je est un autre« - Arthur Rimbaud 1871
Heim, Heimat, Heimweh gibt es wohl, doch Heimkehr keine - warum weshalb wieso
Wieso weshalb warum - weiß ich doch nicht!
Als ich zurück kam, war ich sehr alleine
Paar Fressen fand ich, aber kein Gesicht
Ich traf zwei alte Feinde, treu giftgelbe
Traf einen immergrünen Freund sogar
Ich selber aber war nicht mehr derselbe
Ich ist ein Anderer - das ist doch klar!
An meiner Tür ein Schild mit neuem Namen - warum weshalb wieso
Am offnen Fenster steht ein fremder Mann
Canaillen seh ich nun, die nach mir kamen
Die ich nicht hassen darf, noch lieben kann
Ein Held, der wieder auftaucht, ach! vom Grunde
Aus dem Inferno, nach den Metzelei'n
Den beißen nicht mal mehr die alten Hunde
Ich bin Legende ohne Totenschein
Helene Weigel. Und Ernst Busch. Und die Hurwicz - warum weshalb wieso
Ich brüllte Eislers Brecht am Schrottklavier
Für Ekke Schall, für seine neuste Schnepfe
Soff Wodka mit dem Büffelgras zum Bier
BE! - Wo sind sie alle hin, die Penner
Jetzt starr ich wie verrückt Visagen an
Und denk: so grinste Stasi-Schiefmaul, wenn er
Vor meinem Haus rumhing, als Jedermann
Heim, Heimat, Heimweh gibt es wohl, doch Heimkehr keine - warum weshalb wieso
Wieso weshalb warum - weiß ich doch nicht!
Als ich zurück kam, war ich sehr alleine
Paar Fressen fand ich, aber kein Gesicht
Ich traf zwei alte Feinde, treu giftgelbe
Traf einen immergrünen Freund sogar
Ich selber aber war nicht mehr derselbe
Ich ist ein Anderer - das ist doch klar!
(2006)
- Und diese bittere letzte Zeile: Ich bin Legende ohne Totenschein ... ist ab heute für mich wunderbar falsch geworden. Ich bin von nun an als Ehrenbürger der Stadt Berlin fein raus - ich avancierte nun zu einer Legende mit einer amtlichen Lebensbescheinigung, ich habe nun mein Papier mit Stempel und Unterschrift sogar des Bürgermeisters persönlich auf feinstem Senats-Bütten in goldgeprägter Leder-Mappe, geschmückt mit dem Berliner Bären als Wappentier. Ich verdanke es solchen Politikern in Berlin wie dem echten Sozi Wolfgang Thierse und dem nüchternen Philosophen Richard Schröder. Solche geschichtsbewußten Sozialdemokraten haben ihre Berliner Genossen ermahnt, einer Ehrenbürgerschaft für Biermann in letzter Minute doch noch zuzustimmen. Sie mahnten bei ihren Genossen Wowereit und Müller und Mompert eine lebenskluge Heuchelei an, aus den guten Gründen der politischen Vernunft. Ich verdanke diese Ehrung solch einem linken Rechten wie dem CDU-Berliner Uwe-Lehmann Brauns und solchen Grünen, die ich immer meinte, wenn ich ihre Partei wählte: Marianne Birthler und Franziska Eichstädt-Bohlig.
Erlauben Sie mir ein versöhnliches Wort zum parteitaktischem Hickhack um die Ehrenbürgerschaft. Ich danke den Abgeordneten der PDS, daß sie in kaderkrampfiger Geschlossenheit meine offen und ehrlichen Feinde blieben. Die reaktionären Erben der DDR-Nomenklatura haben auch damit mal wieder einen Akt politischer Aufklärung geliefert.
Der Regierende Bürgermeister zelebrierte uns eben als Prolog seiner Lobrede den verständlichen Protest gegen meine Bemerkung über die schändliche Liaison SPD-PDS. Ich hatte diese vorgestern auf der Buchmesse in Leipzig „verbrecherisch“ genannt. Ich will dieses Wort korrigieren im Sinne des berühmten Satzes von Talleyrand zu Napolen: "Sir, das war schlimmer als ein Verbrechen, das war ein Fehler.“
Ich weiß, daß einige Gäste hier und manche Journalisten vornehmlich darauf lauerten, ob und wie der gewiefte Bürgermeister Wowereit sich nun als Laudator elegant aus der Affäre zieht. Ich aber denke, es war gar keine Affäre, sondern eher ein kleines Lehrstück für nüchterne Realpolitik. Wie es auch sei - eine Kursänderung bei aufkommendem Sturm wagt jeder erfahrene Segler auf dem Wannsee. Und sogar eine Kehre in den sicheren Hafen des Machtkalküls ist ein Menschenrecht, und das muß auch für Politiker auf dem Trockenen gelten. Orientieren Sie sich in solchen Lebenslagen getrost an meinem Lied, das ich ja auch für mich selbst geschrieben habe: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu ...“
Ich sehe sogar eine gelegentliche Heuchelei in höchster Not als läßliche Sünde, wie auch eine Notlüge erscheint sie mir in einem milden Licht. Wer heuchelt, der kennt immerhin die Wahrheit, denn sonst würde er ja gar nicht heucheln. Ein Heuchler muß kein kompletter Lump sein, denn er erweist der Wahrheit indirekt ja doch die Ehre: Er kennt wenigstens das Wahre, das Richtige, das Bessere. Das extreme Gegenstück: Adolf Hitler - was der dachte, das sagte er und tat es dann auch. Sein fanatischer Wiedergänger in Teheran ist auch kein Tartüff, denn er sagt ehrlich und öffentlich genau das, was er fühlt und denkt, was er vorhat und dann auch in die Tat umsetzen wird, also: Die Endlösung der Judenfrage mit einer Atombombe auf das winzige Israel.
Der Zeitgenosse des Molière, François de la Rochefoucauld, hat das Lob der Heuchelei schon vor über dreihundert Jahren geistreich formuliert. Er schenkte uns das lebenskluge bonmot: „Heuchelei ist eine Huldigung, welche das Laster der Tugend darbringt.“
Nur ich armer Hund habe - im Sinne einer déformation professionelle poétique - den Nachteil, daß ich leider leider leider nicht heucheln darf. Mein Publikum würde mir meine Heuchelei womöglich verzeihen oder auch gar nicht merken. Aber ach! die Musen sind schrecklich hysterische Frauen. Sie haben eine überempfindliche Nase für den Gestank der Heuchelei. Und solange ich von der Muse der Dichtung Erato und von der Musikmuse Euterpe und von meiner schönen Frau Pamela noch geküßt werden möchte, kann ich mir Heuchelei einfach nicht leisten.
Ich will Ihnen zum Schluß verraten, warum mich diese höchste Berliner Auszeichnung nicht so leicht aus der Fassung bringen kann: Weil ich verwöhnt bin. Mir wurde nämlich soeben eine noch höhere Ehrung zuteil. Meine Tochter Mollie, sie ist grade sechs Jahre alt geworden, malte mit Tuschefarben mein Portrait und schenkte mir das bunte Bild. Dazu lieferte sie eine drollige Bild-Unterschrift, mit Bleistift gekrakelt. Und all das in der fremden englischen Sprache, weil das arme Kind in seinem Hamburger Kindergarten noch nichts Deutsches schreiben gelernt hat:
My Dad
My dad plays the guitar and sings. He watches television. He often goes to
Berlin to sing. I like my dad, because he makes me laugh.
Ich finde, das paßt ideal zum heutigen Tag hier im Roten Rathaus: Mein Dad spielt Gitarre und singt ... Er geht oft nach Berlin, um dort zu singen... Auch das paßt prima! Aber nun sagen Sie selbst: Was sind schon alle Literaturpreise und Orden und Ehrungen auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten, gemessen an diesem Zertifikat! Eine höhere Auszeichnung kann es nicht geben, als wenn ein Kind sagt: Ich mag meinen Papa, weil er mich zum Lachen bringt.
Wir verkennen die Tragik des Nahostkonflikts und sympathisieren in vormundschaftlicher Verachtung mit radikalen Moslems.
Eine Gastvorlesung von Wolf Biermann in Jerusalem und Haifa im Oktober 2006
Dieses Fragment eines deutschen Sittenbildes könnte für euch, liebe Freunde hier im Nahen Osten, von Interesse sein: Es gibt - hauptsächlich im Westteil des wiedervereinigten Deutschland - seit zehn Jahren die Initiative eines Aktionskünstlers, Gunter Demnig. Das schön mehrdeutige deutsche Wort „Stolperstein“ inspirierte ihn dazu, handflächengroße Messingplatten wie Straßenpflastersteine in die Bürgersteige einzulassen. Darauf eingestanzt sind Geburtsdatum und Name sowie Datum der Verschleppung eines Menschen, der einmal in jener Straße gewohnt hat. Diese „Stolpersteine“ erinnern in der Regel an ermordete Juden, aber es gibt wohl auch einige für Sinti und Roma, für Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle. In meiner Vaterstadt Hamburg liegen schon über tausend Stolpersteine, man könnte sagen: Sie bilden in ihrer Gesamtheit ein dezentrales Großdenkmal.
Ich selbst müßte zwanzig solcher Steine für meine ermordete Familie bestellen, aber meine Frau Pamela und ich zögern, weil der Gedanke uns wehtut, daß die Nachgeborenen nun die Namen meiner Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen mit Füßen treten. Folgende Straßenszene ist dieser Tage in Hamburg in der gutbürgerlichen Isestraße passiert. Zwei junge Frauen knieten vor fünfen solcher Steine, polierten die stumpf gewordene Oberfläche. Mein Freund, ein Israeli, der hier in Hamburg lebt, war neben den beiden außergewöhnlichen Putzfrauen stehengeblieben. Er entzifferte die eingravierten Namen. In diesem Moment kam ein etwa fünfzig Jahre alter Mann vorbei. Auch der blieb stehn und sagte nun, im ehemaligen Judenviertel der Hansestadt Hamburg, den Hammersatz: "Na, diese fünf Juden können jetzt wenigstens nicht mehr im Libanon die Araber ermorden … “ - sagte es und ging gelassen weiter.
Liebe Freunde hier in Erez Israel! Der vielleicht deutscheste aller deutschen Dichter, Friedrich Hölderlin, schrieb seiner Ode An die Deutschen: „Spottet nimmer des Kindes, wenn noch das alberne / Auf dem Rosse von Holz herrlich und viel sich dünkt, / O ihr Guten! auch wir sind / Tatenarm und gedankenvoll!“ Tatenarm war das deutsche Volk unter seinem vergotteten Führer Adolf Hitler gewiß nicht mehr. Gedankenvoll waren die Deutschen in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges und des Völkermords auch nicht. Aber die Welt hat sich wild gedreht. Inzwischen ist der Vers wieder halb richtig. Herausragend gedankenvoll sind wir Deutschen nicht mehr, aber tatenarm - das sind wir wieder geworden. Scham über ihre Untaten hat die Deutschen nach 1945 in mürrische Ängstlichkeit gelockt. Sie wollen als Volk nicht erwachsen werden. In Bezug auf die globalen Konflikte, etwa den Krieg zwischen Israel und seinen Todfeinden, sitzen die Deutschen tatenarm auf dem Schaukelpferd der Weltgeschichte.
Rein ökonomisch ist das wiedervereinigte Deutschland ein erwachsener erfolgreicher Mann, militärisch ein halbstarker Schwächling, der sich als Sanitäter und Aufbauhelfer in Krisenregionen schicken läßt. Aber weltpolitisch wollen die Kinder der Nazigeneration partout nicht runter vom Schaukelpferd einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dieses Sich-aus-allem-Heraushalten, diese scheuschlaue, lebensdumme Tatenlosigkeit im Streit der Welt ist in der praktischen Auswirkung ein Tun, will sagen: folgenschweres Lassen.
Aus meiner Sicht war es ein Fehler, daß Deutschland sich im Jahre 2003 nicht auf die Seite der Amerikaner und Engländer gestellt hat im Streit um den Irak. Ich bin sogar der Meinung, daß der französische Präsident Chirac und sein kleiner deutscher Kumpel, der falsche Pazifist und Bundeskanzler Schröder, eine große Mitschuld am Irakkrieg der Amerikaner und Briten gegen das Terror-Regime von Saddam Hussein haben. Der Krieg vor drei Jahren hätte womöglich vermieden werden können, weil der Diktator abgetreten wäre, hätte der Westen mit einer Zunge gesprochen, mit einer Faust gedroht. Ja, ich denke, daß die Deutschen und die Franzosen schuld am Schicksal dieses Monumental-Lumpen sind. Weil sie durch ihre Appeasement-Politik Saddam Hussein suggerierten, er käme mal wieder elegant davon mit seinen totalitären Tricks, blieb der Diktator stur. Saddam rechnete nicht damit, daß Bush und Blair so naiv sein würden und einen Krieg wagen ohne ihre wichtigsten Verbündeten Chirac und Schröder. Seine Phantasie reichte nicht aus, sich vorzustellen, daß er aus seinen parfümierten Kitschpalästen in ein stinkendes Dreckloch, dann in einen Eisenkäfig vor Gericht und an den Galgen geraten könnte.
Über all diese Fragen streite ich mich hier in Israel gelegentlich mit Freunden. Ich lebe auch sehr angenehm mit kritischen Freunden umgürtet in meiner Vaterstadt Hamburg. Aber zum Vaterland wurde mir in den letzten Jahren immer mehr dieses fremdvertraute Israel. Besonders die westeuropäisch orientierten, die aschkenasischen Israelis sind immer tiefer enttäuscht über die aggressive Ignoranz der westlichen Welt, die sich die Nahosttragödie wie eine Seifenoper anschaut. In mir aber wächst Furcht, denn das nahöstliche Israel ist der bedrohteste Teil der fernwestlichen Zivilisation.
In diesem historischen Trauerspiel nämlich kann es kein Happy-End geben. Wir wissen doch alle seit Sophokles, daß in einer echten Tragödie immer alle widerstreitenden Parteien aus ihrer Position recht haben und daß die Personae dramatis deshalb nur entscheiden können, ob sie diesen oder lieber einen anderen Fehler machen. Falsch ist alles! Ja, heillos ist in dieser tragischen Konstellation jedes Tun und Lassen. Und jeder Weg führt in die Katastrophe. Den Gaza-Streifen besetzen ist falsch, den Gaza-Streifen räumen ist falsch. In Deutschland lieben es die Meinungsmacher, den Zaun, mit dem sich Israel schützt, in Erinnerung an das geteilte Deutschland gehässig eine Mauer zu nennen. Ich lebte lange genug hinter der Berliner Mauer und weiß, wie zynisch diese Gleichsetzung ist. Dennoch bleibt das Dilemma: Diesen Zaun zu bauen ist falsch, aber den Zaun nicht zu bauen ist - vermute ich - noch falscher.
In Deutschland sage ich klipp und klar: Die ungeduldigen Zuschauer müssen endlich kapieren, daß es keine Lösung gibt für den Konflikt zwischen Juden und Arabern. Hier in Israel sage ich das Gegenteil: Die verzweifelten Israelis müssen einsehen, daß es doch Lösungen gibt. Warum? Weil es sie geben muß.
Der Staat Israel hatte in Deutschland schon eine bessere Presse. Drei Jahrzehnte nach dem Holocaust hatten die Deutschen dem jüdischen Volk schon fast verziehen, was sie ihm angetan haben. Doch nun werden die Täter mehr und mehr ungnädig angesichts dieses heillosen Dauerkonflikts ihrer Opfer. Immer wieder höre ich das kalt-herzliche Argument: Diese Juden müßten doch während der Nazizeit am eigenen Leibe gelernt haben, was Unterdrückung ist. Na eben drum! halte ich dann heiß-herzlos dagegen, die Überlebenden haben die Schoah-Lektion gelernt und wollen sich niemals wieder abschlachten lassen.
Die simpleren Durchschnittsdeutschen ergreifen Partei für die Araber. Es wird wieder der Refrain des alten Liedes geschwiegen, geknurrt und geplärrt: Die Juden sind an allem schuld! Und auf den reflexhaften Vorwurf des Antisemitismus antworten unsere modernen Judenhasser cool: „Man wird Freunde doch kritisieren dürfen!“ Mit dem scharfen Auge starren die Deutschen auf die Juden in Israel, mit dem triefenden Auge glotzen sie auf die Araber in Palästina. Das romantische Verständnis der Deutschen für die Islamisten im Nahostkonflikt hat aber Gründe. Sie halten Araber für affige Wilde, für unmündige Menschen dritter Klasse, an die man noch keine aufklärerisch-humanen Maßstäbe anlegen darf. Die Zuneigung der Deutschen ist eine Art von vormundschaftlicher Verachtung. Der schwärmerische Respekt vor dem Fremdländischen ist nur _Bequemlichkeit und Hochmut. Ich sehe im Multi-Kulti-Ge_schwärme meiner alter_nativen Zeitgenossen die seitenverkehrte Version des Rassendünkels von gestern.
Wenn die Zahlmeister der EU regelmäßig Alimente an die Palästinenser überweisen, dann wollen sie es nicht wahrhaben, daß sich im Gaza-Streifen die abgeklärten Massenmörder der Fatah mit den fanatischen Massenmördern der Hamas eigentlich nur über den Weg zur Endlösung der Judenfrage streiten, denn im Grunde sind sie alle einer Meinung: Israel muß vernichtet werden!
Leider trägt es zur Aufklärung bisher wenig bei, wenn in großen Zeitungen sogar die skandalöse Hamas-Charta abgedruckt wird: „Israel wird aufsteigen, bis der Islam es vernichtet, so wie er seine Vorgänger vernichtet hat. … Dank der Ausbreitung der Moslems über die ganze Welt, die die Sache von Hamas verfolgen …, ist die Bewegung eine universelle. … Wer ihren Wert anzweifelt oder es vermeidet, sie zu unterstützen, oder so blind ist, ihre Rolle zu leugnen, fordert das Schicksal heraus. … Der Prophet, Segen und Friede sei mit ihm, hat gesagt: Der jüngste Tag wird nicht kommen, bevor nicht die Moslems gegen die Juden kämpfen (und die Juden töten) und der Jude sich hinter Steinen und Bäumen verbirgt. Die Steine und Bäume werden sagen: Oh Moslem! da versteckt sich ein Jude hinter mir, komm, töte ihn! … Friedensinitiativen laufen allesamt den Überzeugungen der Hamas zuwider.“
Der Slogan „Die Juden sind an allem schuld“ ist offenbar so unausrottbar wie das dumme Vorurteil, daß alle Juden besonders intelligent sind. Die Juden waren und bleiben auch nach Meinung des gebildeten Elite-Packs an allem schuld. Schuld sind die Juden am Amoklauf der bombenumgürteten Selbstmordmörder der Hamas und der Hisbollah. Die jüdischen Neo-Cons in New York haben den bigotten Simpel George W. Bush in den Krieg gegen den Diktator Saddam Hussein getrieben. Die Juden sind durch ihre globale Machtpolitik schuld an der Atombombenproduktion Irans. Der Geldjude treibt im Börsengeschäft mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF) die armen Länder immer tiefer in die Schuldenfalle. Diese Idioten-Logik gilt auch für gebildete Schwachköpfe, die jüdischen Kriegsgewinnlern die Schuld dafür geben, daß die deutschen Steuerzahler jetzt teure Kriegsschiffe in den Libanon schicken müssen. Die überchochmetzte Variante: Wir müssen die Juden schützen vor den Juden.
Journalistische Ausgewogenheit der Berichterstattung über den Nahostkonflikt ist für das populäre deutsche Wochenmagazin stern nur noch ein Feigenblatt in Fingernagelgröße. Und das wirkungsmächtigste Blatt des Westens, der Spiegel, beugt sich der antiisraelischen Stimmung in Deutschland und bestärkt sie zugleich im Tonfall augenzwinkernder Ausgewogenheit. Auch die meisten Nachrichten im Radio, die verschiedenen Fernsehsender - fast alle singen mit falscher Stimme und echtem Gefühl, so wie das deutsche Harfenmädchen in Heines Wintermärchen.
Währenddessen brennt Israel unter dem Raketenhimmel. Die Juden sitzen wieder in den Bunkern, fliehen von Norden nach Süden. Aber das Land ist klein. Die arabischen Raketen fliegen immer weiter und treffen immer genauer. Der Libanon brennt unter dem _Bombenhimmel der blindverzweifelten Super-Militärmacht Israel. Standardkommentar der Deutschen: »Und das alles nur wegen zwei entführter Soldaten!« Wie früher in den Weisen von Zion die Juden als Christenkinderfresser, so werden heute die Israelis als Kinderschlächter dargestellt, die eine christlich-moslemische Zivilisation in die Steinzeit zurückbomben wollen. In Wirklichkeit aber sind es Araber, die Israel ausrotten und im nächsten Schritt die gesamte westliche Zivilisation vernichten wollen.
Mein alter Freund, der Historiker des Jüdischen Widerstands, Arno Lustiger sagte mir: Wenn die Araber die Waffen endlich niederlegen, wird es keinen Krieg mehr geben. Aber wenn Israel die Waffen niederlegt, wird es kein Israel mehr geben.
Jedes tote arabische Kind ist ein kleiner Sieg im Medienkrieg. Der Anführer der Hisbollah predigt im Libanon mit seiner sanften Stimme, daß arabische Bürger des Staates Israel, die gelegentlich von den Raketen der Hisbollah getötet werden, froh sein sollen, denn sie werden als Märtyrer in Allahs Paradies eingehn. Und der durchgeknallte Führer des Iran, der das Gemetzel finanziert, schreibt die Reden von Goebbels und Hitler ab, schülerhaft wortwörtlich. Alle Welt rechnet damit: Der Iran wird bald seine Atombombe haben und die Trägerraken als fliegende Perserteppiche dazu. Ahmadineschad drohte: Wir werden den Juden einen Gefallen tun und ihre Auschwitz-Lüge in eine Wahrheit verwandeln, denn wir werden die Endlösung der Judenfrage verwirklichen.
All diese Informationen sind in deutschen Massenmedien präsent, aber es kratzt die Masse der Bevölkerung nicht. Der Chef des Iran machte der staunenden Menschheit eine makabere Rechnung auf: Wenn bei einem atomaren Krieg eine Atombombe auf Israel falle, seien endlich alle 5 Millionen Juden auf einen Schlag tot. Wenn aber Israel kurz vorher noch die Raketen für den Gegenschlag abfeuere, werden vielleicht 15 Millionen Araber sterben - was tut das! Dann haben wir eben 15 Millionen Märtyrer mehr im Himmel, aber auf der Erde bleiben über eine Milliarde Moslems am Leben, um die Welt zu erobern. - Auch den Deutschen sind diese Fakten bekannt, und trotzdem stecken sie den Kopf in den Sand, sie kuschen vor radikalen Moslems mit vorauseilender Feigheit. Sie wollen sich durch Wohlverhalten die Exportmärkte erhalten, die Rohstoffquellen sichern und sich die Terroristen im eigenen Lande vom Halse halten. Es gibt in Deutschland einen spöttischen Spruch über den Schutzpatron der Feuerwehr: „O heiliger Sankt Florian! / verschon mein Haus, zünd andre an!“
Ist es Ihnen ärgerlich aufgestoßen? Ich sage ungeniert DIE Amerikaner, DIE Juden, spreche von DEN Arabern, DEN Israelis. Ich sage auch DIE Deutschen! Kein Besserwisser muß mir erklären, daß es sehr verschiedene Deutsche, Juden, Araber, Israelis und Amerikaner gibt.
Was mich anwidert, das ist die großmäulige Besserwisserei der Wenigwisser in Europa gegen_über dem Nahostkonflikt. Die gröberen Deutschen habe ich geschildert. Die feineren Deutschen sind moderater. Sie halten sich bedeckt mit schmallippiger Äquidistanz. Sie sagen: Juden und Araber sind gleich schuld! Die Streithähne sollen sich endlich vertragen! Politische Schöngeister werfen sich in die ironische Pose der schönen Donna Blanca aus Heines berühmtem Gedicht Religionsdisput, wo am Ende der Maulschlacht zwischen Rabbi und Pfaffe die junge Königin in der Loge sitzt. Der König hat schon die Schnauze voll von dem Wortegemetzel der gottvergifteten Eiferer und fragt seine Frau: Wer von beiden hat denn nun gesiegt? Was sie ihm antwortet, ist zum geflügelten Wort geworden: „Welcher Recht hat, weiß ich nicht / Doch es will mich schier bedünken / Daß der Rabbi und der Mönch, / Daß sie alle beide stinken.“
Ja, jeder Krieg stinkt. Böse sind auch die Krieger aufseiten der Guten. Unrecht tun auch die Kämpfer, die ihre Freiheit verteidigen. Es brüllen auch die Gerechten, wenn sie blindwütig um ihr Überleben kämpfen. Doch immer mehr Kommentatoren erklären, daß in Nahost kein Rassen-, kein Klassen- und kein Religionskrieg tobt, sondern ein Krieg der Kulturen. Die Welt des Islam scheint heute gegen die Werte des Abendlandes zu stehen. Ich aber sehe in diesem Konflikt zweier angeblich nicht kompatibler Kulturen ein Scheinproblem. Für mich gehören auch die Millionen Moslems zur sogenannten Zivilisation. Es sind die Nachfahren einer altehrwürdigen geistigen Tradition. Geniale Baumeister, göttliche Handwerker, begnadete Dichter, weise Philosophen. Es sind die Nachgeborenen von Abrahams Sohn Ismael, die schon den Lauf der Sterne berechneten, als wir in den Wäldern Germaniens noch auf der Bärenhaut schnarchten.
Und schon gar nicht kann ich ein Feind der unterdrückten arabischen Völker sein, die heute in totalitären Militärdiktaturen verblöden, in gotteslästerlichen Gottesstaaten verkommen. Sogar die fanatisierten Intifada-Kids und ihre todtraurig-jubelnden Heldenmütter und all die analphabetischen Männer, wie sie im Westjordanland für jeden falschen Märtyrer Freudentänze machen, kann ich nicht so einfach aus meiner Menschheit ausschließen. Aber die Palästinenser werden von ihren arabischen Brüdern selbst aus der Menschheit ausgeschlossen und vorgeschickt in einen tödlichen Kampf. Die riesigen reichen arabischen Länder rund um Israel mit ihren gewaltigen Ressourcen an fruchtbarem Land und Bodenschätzen und alter Hochkultur sollten ihre Ölmilliarden investieren, um diesen Elendsten ein friedliches Leben zu ermöglichen.
Denn es hilft gegen Gewalt außer Gewalt auch Gewaltlosigkeit. Ja, es hilft auch Gerechtigkeit, es helfen Liebe und Güte, womöglich Bildung, Verzeihen und selbstkritische Demut. Aber das bleibt für mich das humane Drama: Ohne entschlossene Gewalt gegen bis an die Zähne bewaffnete religiöse Fanatiker oder andere fundamentalistische Menschheitsretter haben wir Menschen nicht mal die Chance zu einem Streitgespräch über die letzten Dinge zwischen Himmel und Erde.
Eurem zionistischen Gründungsvater David Ben Gurion wird der Satz in den Mund gelegt: „Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist.“ - Ich stand in der Negev-Wüste im Kibbuz Sede Boker zusammen mit der israelischen Schriftstellerin Jonath Sened. Sie hat als kleines Mädchen bei Jizchak Katzenelson in einem Keller im Warschauer Ghetto Hebräisch gelernt. Sie zeigte mir das Arbeitszimmerchen eures Staatsgründers. Mir gefällt sein berühmter Satz. Auch ich glaube an Wunder, denn es ist schon ein doppeltes Wunder: Erstens, daß es uns Menschen überhaupt gibt. Und zweitens, daß wir noch immer leben. Ich glaube an das verzweifelte Lied aus dem Ghetto Wilna im Jahre 1943: „Mir lebn ejbig …“
Hoffmann von Fallersleben.
Rede am 1. Mai 2006 in Höxter
Geht es nicht auch Ihnen so? Ein kleine Landschaftsmalerei, irgendeine Novelle, ein Spottgedicht, ein Franz-Schubert-Lied, ein jazziger Song, ein schnulziger Schlager oder ein sentimentales Chansons – alles, was man in einer längst vergangenen Lebenszeit in sich aufgenommen und verinnerlicht hat, dann aber scheinbar vergessen hatte – dieses eine bestimmte Kitsch- oder Kunstwerk - egal! - es verknüpft sich sentimental mit diesen und jenen Glücksmomenten, mit den positiven Gefühlen, mit bestimmten Menschen aus einer längst verflossenen Zeit. Wie das Signal der Klingel beim Pawlowschen Hund die Bauchspeicheldrüse zur Sekretion animiert, so sondert des alten Wolfes Hirn ein Glückshormon ab, wenn der richtige Ton erklingt. So kommt es also, daß ich ausgerechnet bei dem banalen Schlager „Der alte Seemann kann nachts nicht schlafen...“ an meine allererste Freundin Ina M. denken muß in Gadebusch, an Ihre dunklen Schattenmorellen: die melancholisch umschatteten Augen. Ich sehe vor mir das heilignüchterne Liebespaar im Internat, dessen Hälfte ich selber war. Ich rieche den Duft des Lachens meiner Schönen, wenn im Radio zufällig die alte Weise gesendet wird, die damals aus dem Radio plärrte, als ich so selig die Flügel ihrer Augenbrauen küßte und meine kecke Zunge vom großen Rot ihrer Lippen bis rüber wanderte zum Ohrläppchen mit dem kleinen Rubin.
Diese Erinnerungsautomatik funktioniert auch im Negativen. Und so kommen wir gleich zu Hoffmann von Fallersleben. Ich will Ihnen etwas Spezielles zur Wirkungsgeschichte seines allergrößten Hits liefern, denn alles Andere kennen Sie längst und besser als ich. Sie kennen die Legende aus dem Kriegsbericht der deutschen Heeresleitung vom 11. November 1914 über die Jünglinge, die für ihren Kaiser Wilhelm bei Langemaak in die Schlacht ziehn, um zu schlachten und abgeschlachtet zu werden, mit Hoffmanns Lied auf den Lippen:
"Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange "Deutschland, Deutschland über alles" gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie"... Friedrich Ebert 1922, als er Hoffmanns Lied zur Nationalhymne der Weimarer Republik machte. Zum Deutschlandlied der Nazis werde ich Ihnen gleich ein kleines politisches Sittenbild zeichnen. Dann 1952 das politische Geschäft zwischen Adenauer und Heuß, als sie die dritte Strophe des verboteten Liedes für uns retteten: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland ... Dann 1954 die Schlachtenbummler beim Wunder von Bern, als sie grölten: Deutschland, Deutschland, Deutschlands Fußball über alles in der Welt ... dann der Zusammenbruch des Ostblocks, als Bundespräsident Weizsäcker und Kanzler Kohl im August 1991 die beste Strophe in Hoffmanns Lied ein für alle mal zur Hymne der wiedervereinigten Deutschen machten ...
Ich weiß ja: all solche historisch gewordenen Klingeltöne provozieren bei uns allen sehr verschiedene pawlowsche Reflexe: Speichel wird abgesondert, Schaum vor dem Mund, Angsschweiß, Galle der Wut und womöglich Tränen der Scham. Das Hin- und Her um dieses Lied der Deutschen setze ich bei Ihnen hier als bekannt voraus. Wer wollte schon Hoffmann von Fallersleben nach Höxter tragen - wie Eulen nach Athen!
Ein Kuriosum, das manche gar nicht kennen: Hoffmann schrieb ausgerechnet sein heikles Schicksalsslied der Deutschen im Ausland, fern der Heimat, 1841 im Urlaub auf der damals noch britischen Fischer-Insel Helgoland. Umtost von den Wellen der Nordsee dichtete er diese so ideal mißbrauchbare Zeile „Deutschland Deutschland über alles ...“ und er verkaufte seinen frischen Fang direkt am helgoländer Strand für französisches Geld an seiner Hamburger Verleger Campe.
Erst viele Jahre Jahre nach Hoffmanns Tod, 1890, tauschte der Kaiser Wilhelm einen Teil seines Kolonialbesitzes in Deutsch-Ostafrika, die Insel Sansibar, gegen die strategisch wichtige Festung Helgoland, den roten Felsen vor der deutschen Küste.
Wir sitzen hier nicht in einem Kursus der Volkshochschule. Also fange ich mit diesem Stück Weltgeschichte klein klein an, so extrem privat, daß es mir selber schon peinlich wird. Und peinlich muß es doch sein, wenn Sie und auch ich etwas davon haben wollen. Sowas vergessen wir manchmal: das Wort „peinlich“ bedeutet ja nichts anderes als schmerzhaft. Und wenn sie radikal wahrhaftig ist, dann tut die Wahrheit eben manchmal weh. Ich kann mich genau daran erinnern: Es passierte mir im Sommer 1936. Da schwamm ich noch selig im Fruchtwasser meiner Mutter Emma Biermann, also im bequem gewölbten Bauch, in einer Phase der Schwangerschaft, als er sich noch nicht gesenkt hatte. Es könnte also im Altweibersommer gewesen sein, und ich war schon im sechsten Monat.
Mein Vater Dagobert hatte als Kommunist grade eine zweijährige Haftstrafe im gefürchteten Zuchthaus Fuhlsbüttel abgesessen. Er war also seit einem knappen Jahr raus aus dem Naziknast und wieder drin im normalen Arbeitsleben. Er war wieder eingestellt worden von der Werft Blohm & Voß. Dort wurde in dieser Zeit das Kraft-durch-Freude-Schiff „Wilhelm Gustloff“ gebaut und der KdF-Luxusdampfer „Horst Wessel“. Mein Vater war ein hochkarätiger Schlosser-Maschinenbauer und spezialisiert auf die Wartung der elektrischen Laufkatzen, die über die Stahlseile der Hellige immerzu hin und her fahren. Mit dieser Kran-Technik wurden, damals, die schweren Eisenteile für die Schiffsbauer von oben herunter gelassen, genau dorthin über dem wachsenden Schiffsrumpf, wo dann die Nieter mit ihren schweren Hämmern die hell glühenden Nieten platt schlugen und so die vorgeformten Stahlteile zusammenfügten.
Da über die Wochentage ununterbrochen im Schichtsystem gearbeitet wurde, standen nur am Wochenende diese Laufkatzen nicht unter Strom, sodaß anfällige Reparaturen am Sonntag von einer Kolonne Spezialisten erledigt wurden. Es war also ein sonniger Sonntagabend, als mein Vater mit vielleicht fünf seiner Schiffsbauer von der Sonderschicht kam. Ein befreundeter Barkassenführer hatte die kleine Gruppe mit seinem Schiffchen nicht nur rüber über den Fluß zu den Landungsbrücken Sankt Pauli gebracht, sondern war ein paar Minuten extra elbabwärts geschippert. In Höhe des Biergartens der großen Brauerei am Elbhang hinter Teufelsbrück ließ er am schwimmenden Anleger die Kumpel an Land.
Die Gruppe der Werftarbeiter setzte sich also an einen freien Tisch am Rande dieses großen Biergartens, der an diesem Sonntag gerammelt voll war mit hanseatischen Herrschaften, alle im vollen Wichs: Offiziere in Uniform, aufgetakelte Damen und ordengebeugte Veteranen des 1. Weltkriegs, nun in Zivil schön geschniegelt gebügelt im dunklen Sonntagsstaat, die Würdigsten noch mit Zylinder. Der Slogan „GEBT UNS UNSREE KOLONIEN WIEDER!“ stand als girlandenumkränzte Losung über der Veranstaltung. Es war also ein Traditions-Treffen des deutschnationalen Kolonialvereins. Alte schwarzweißrote Kriegsflaggen des Kaiserreichs schmückten das Areal, bunt gemischt mit den moderneren Hakenkreuzfahnen. Ein Redner feuerte Wortsalven in die Menge.
Die Kellnerin brachte jedem der Arbeiter ein Bier und meiner Mutter eine grünprickelnde Waldmeister-Brause. Die Gläser der kleinen Gruppe waren noch halb voll, als nun zum Abschluß der Feierlichkeiten das obligate Deutschlandlied geschmettert wurde. Die Gesellschaft erhob sich von den Gartenstühlen, Frauen wie Männer rissen den Arm hoch zum Hitler-Gruß. Auch die Kollegen meines Vaters lüfteten im Reflex ihren Hintern vom Stuhl. Als sie aber bemerkten, daß ihr kleiner Chef sturstolz sitzen blieb, verharrten sie für einen Moment in dieser Bewegung ... und ... setzten sich dann, einer nach dem anderen, mehr oder weniger zögerlich, wieder hin. Es war – was Wunder! – eine wacklige Situation.
Es ist klar, daß diese Arbeiter wissen mußten, daß mein Vater grade als Politischer aus einer Zelle in Fuhlsbüttel gekommen war. Unter diesem moralischen Druck schämten sie sich. Aber vor dem Terror der Nazis mußten sie sich fürchten. Die Scham war offenbar bei diesen Hamburgern, gut zwei Jahre nach der Machtergreifung, immer noch etwas größer als ihre Angst. Also blieben sie alle sitzen. „Deutschland Deutschland über alles ...“ - sofort stürzte ein Herr an ihren Tisch und schnarrte: „Wollen Sie gefälligst der Deutschen Hymne die Ehre erweisen!!“ - Mein Vater schnarrte im nachgeäfften Offizierston zurück: „Stören Sie gefälligst nicht die Zeremonie!! Das regeln wir noch!!!“ Der Herr verließ verwirrt den Tisch. Im Nu griffen die Sitzengebliebenen nach ihren Gläsern und kippten sich den Rest in den Hals. Dann legten sie die Zeche für das Bier auf den Tisch. Als nach dem Deutschlandlied, wie es zur Regel geworden war, das Horst Wessel-Lied mit allen Strophen abgesungen wurde, verließ die kleine Gruppe das Lokal.
Die Fahne hoch!
Die Reihen dicht geschlossen!
SA marschiert
Mit ruhig festem Schritt
Kam'raden, die Rotfront
Und Reaktion erschossen,
Marschier'n im Geist
In unser'n Reihen mit
Mit schmalem Hintern verdrückten die Werftarbeiter sich so schnell wie möglich, aber auch so unauffällig langsam wie nötig - bloß raus auf die Elbchaussee! Aber als sie um die erste Ecke waren, rannten sie in panischer Angst hemmungslos davon. Meine Mutter keuchte hinterher, immer an der Hand meines Vaters. Und ich? Mich schaukelte es wild hin und her in meiner dunklen Höhle.
Als ich dann schon drei Monate alt war, wurde mein lieber Vater wieder verhaftet. Dieses zweite mal war es ernster. Ein Gestapospitzel hatte es geschafft, sich als Antifaschist einzuschleichen, die Widerstandsgruppe flog auf. Die Anklage dann vorm Volksgerichtshof: Hochverrat und Landesverrat. Und das war die Straftat: Die kleine Widerstandsgruppe hatte im Hamburger Hafen die Waffenschiffe ausspioniert, mit denen Nazi-Deutschland, getarnt als Friedensfracht, heimlich Kriegsmaterial verschiffte, Nachschub für Generalfeldmarschall Görings LEGION CONDOR im Spanischen Bürgerkrieg. Der Hauptangeklagte, der jüdische Rechtsanwalt Dr. Michaelis, der auf den Spitzel hereingefallen war, wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mein Vater, dem zum Glück nichts nachgewiesen werden konnte, kam mit sechs Jahren Zuchthaus davon.
Und was kann Hoffmann von Fallersleben dafür? Was überhaupt geht all dies den Dichter an, der im Jahre 1860 eine Anstellung als Bibliothekar beim Herzog von Ratibor in Corvey annahm? Gar nichts! Er kann nichts dafür, aber ich, halten zu Gnaden, auch nicht! Und das ist mein Problem.
Ich hörte in den folgenden Jahren das leidige Deutschlandlied zuhaus in der Küche in Hammerbrook, wenn unser Volksempfänger, genannt „Goebbelsschnauze“, die erste Strophe der Nationalhymne sendete. So was atmet ein Kind ein wie schlechte Luft, ohne groß darüber nachzudenken. Aber an eine herzzerreißende Szene kann ich mich scharf erinnern. Es muß kurz vor dem großen Bombenangriff der Allierten im Juli 1943 gewesen sein. Da war ich schon sechs Jahre alt. Ich lief in Hamburg an der Hand meiner Mutter über die Mönckebergstraße. Vom Hauptbahnhof her überholte uns eine bombastische Marschkolonne mit Tschingdara-Bumm-Bumm. Die Masse formierte sich dann auf dem Adolf-Hitler-Platz vor dem Rathaus und spielte das Deutschland-Deutschland-über-alles-Lied unter dem Fahnenwald. Die Leute drängten sich nach vorne zur Musik, ein einzig Volk aus Heil-Hiter-Gruß-Menschen. Wir standen abseits. Meine Mutter hielt mich an der Hand, mit der Rechten? Plötzlich kam von der Seite ein uniformierter Mann vorbeigeprescht. Er riß mir wortlos die Hand meiner Mama weg und zerrte ihr den Arm hoch zum Hitlergruß, und dabei trat er sie schnell noch pädagogisch in den Hintern und rannte weiter. Es hatte was kindergrausam Spielerisches. Ich weiß nicht mehr, ob sie den Arm dann oben ließ. Aber ich weiß noch den Seelenton, weiß die Bilder, das Gesicht meiner Mama – Sie verstehen: ein irrer Filmfetzen in meinem Gedächtnis.
Und Sie haben längst und gut verstanden: aus der Perspektive meines Lebens kann das berühmteste Lied des Dichters Hoffmann von Fallersleben nichts Gutes, nichts Angenehmes bedeuten. Und darum könnte ich nicht sagen wie Heinrich Heine: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten ...“ Nein, ich weiß in diesem Punkte ganz gut, warum ich so traurig bin, wenn ich dieses Lied höre mit seiner genialen und wunderschönen Melodei von Joseph Haydn.
Sogar dann, wenn ich nur das nackte Kaiser-Quartett höre, ist mir zum Kotzen und zum Fluchen und zum Weinen. Denn ich muß dabei an meine Großeltern John und Louise Biermann denken, an meine Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen. Sie alle, ohne eine einzige Ausnahme, wurden im November 1941 von der Moorweide am Bahnhof Dammtor nahe der Alster in Eisenbahnwaggons nach Minsk deportiert in das Juden-Ghetto und dann dort im Stadtwald in die Grube geschossen.
Nein, nein, nein! - der mißbrauchte Dichter ist ohne Schuld. Und ich weiß so gut wie Sie hier, daß der Autor des mir so tief verhaßten Liedes nicht nur kein Vorläufer der Nazis war, sondern ganz im Gegenteil: sogar ein radikaler Demokrat. Und nebenbei gesagt: Der Dichter war auch ein anrührend schlechter Geschäftsmann. Denn er verkaufte seinem Verleger Campe den Deutschland-Hit für nur wenig mehr als ´n Ei und ´n Butterbrot: für vier Louisdor, die französischen Goldmünzen. Sie sehen: Es gab schon damals eine Art europäischer Währungsunion.
Wie schuldlos der Verseschmied Hoffmann in Bezug auf den Mißbrauch seines Liedes ist, beweist auch die Tatsache, daß in der Nazizeit nur die erste Strophe erlaubt war, die zweite unerwünscht und die dritte über „Einigkeit und Recht und Freiheit ...“ sogar verboten. Und daß Hoffmann nicht Deutschland chauvinistisch oder sogar kriegerisch über alle anderen Länder erheben wollte, sondern einzig über die vielen feudalen Deutschländerchen, versteht sich.
Hoffmann von Fallersleben schrieb damals mit all seinen Kräften an gegen die Zerstückelung seines Vaterlandes, in einer Zeit zudem, als die aufreizend nahen Konkurrenten Frankreich und England schon starke moderne Nationalstaaten waren. Der Poet und Literatur-Professor Hoffmann von Fallersleben dichtete tapfer an gegen all die deutschen Fürstchen und sonstige Despoten. Und er hat auch ehrlich dafür bezahlt. Er verlor seine Professur an der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau und wurde aus dem Königreich Preußen ausgebürgert. Der Grund: seine demokratische und liberale Gesinnung, also seine hochpolitischen Ansichten in den hochpolitischen "Unpolitischen Liedern" der Jahre 1840 / 41. Und wo wurden diese Verse gedruckt? Bei Heinrich Heines Verlag Hoffmann und Campe, der drei Jahre später „Deutschland. Ein Wintermärchen“ auf den Markt warf.
Hoffmanns Zeitgenosse Heinrich Heine schrieb 1851 in der Matratzengruft im Pariser Exil sein berühmtes Gedicht „Enfant Perdu“. Dort nennt Heine sich selbst einen Soldaten, der trotz seiner blutenden Wunden treu Posten steht im Freiheitskrieg. Und ich sehe neben dem Freiheitssoldaten Heine genau so zuverlässig den Hoffmann von Fallersleben Wache stehen. Bei dieser Gelegenheit fällt mir natürlich ein, wie gemein der rotzfreche Heine seinen etwas tümlicheren Kameraden Hoffmann verspottete. Heine nannte den Dichter Hoffmann einen Brutus, der dem Cäsar aber nicht etwa als Tyrannenmörder den Dolch in den Rücken haut, sondern ihm stattdessen grausam beißenden Läuse in den Pelz setzt:
[AN HOFFMANN VON FALLERSLEBEN]
O Hoffmann, deutscher Brutus,
Wie bist du mutig und kühn,
Du setzest Läuse den Fürsten
In den Pelz, in den Hermelin.
Und wen es juckt, der kratzt sich,
Sie kratzen sich endlich tot,
Die sechsunddreißig Tyrannen,
Und es endigt sich unsere Not.
O Hoffmann, deutscher Brutus,
Von Fallersleben genannt,
Mit deinem Ungeziefer
Befreist du uns das Land.
Diese Spottverse vom Heine – vom Olymp herab gespuckt – sind aber doch – leider! - wahr. Denn aus der Sicht Heinrich Heines waren die kunst-gehandwerkelten Verse seines Kollegen Hoffmann von Fallersleben eben keine Dolche, keine Schwerter, Hoffmanns politisch aufmüpfige Pasquille waren keine Löwen im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, sondern ... beißende Flöhe. Trotzalledem: Heine erkannte und anerkannte Hoffmann als seinen Mitkämpfer.
Im Poem ATTA TROLL mokierte Heine sich über die „Tendenzdichter“ seiner Zeit, die zwar Lyrik von 'richtiger' Gesinnung produzieren, aber, ästhetisch betrachtet, leider Schund. Heine dozierte: „Die wahrhaft großen Dichter haben immer die großen Interessen ihrer Zeit anders aufgefaßt als in gereimten Zeitungsartikeln«. Bei solch einem Zitat zucke ich natürlich zusammen und denke: Na, Biermann, Du kleiner DDR-Drachentöter, bist Du nicht auch einer vom Format der Tendenzdichter? Und schlägst Dich jetzt in Höxter selbstgerecht auf die Seite der Welt-Genies? Fragen Sie mich bitte nicht danach, denn über niemanden irrt man sich grotesker als über sich selber.
Hoffmann von Fallersleben kämpfte eben mit den Waffen, die er hatte. Das aber imponiert mir an ihm: Hoffmann verhielt sich tapfer nicht nur gegen die deutschen Despoten, sondern auch gegen all die teutschen Unterthanen, ohne deren Trägheit und Feigkeit die verhaßten Fürsten längst ihre Macht verloren hätten. So riß Hoffmann dem Deutschen Michel die Schlafmütze vom Kopf:
Nicht Mord, nicht Bann, nicht Kerker
Und Standrecht obendrein -
Es muß noch kommen stärker,
Wenn's soll von Wirkung sein
Ihr müßt zu Bettlern werden,
Müßt verhungern allesamt,
Dann, dann vielleicht erwacht noch
In Euch ein neuer Geist,
Der Geist, der über Nacht noch
Euch hin zur Freiheit reißt.
Sie hören ja selbst an diesen zusammenknüttelten Versen – Hoffmanns dichterische Kraft entsprach in der Tat mehr dem Maß der reimenden Mitstreiter Herwegh und Freiligrat. Dennoch wollen wir ihn nicht der billigen Lächerlichkeit preisgeben, indem wir ihn messen an großen Menschheitsdichtern wie etwa Goethe, Hölderlin, Heine.
Nein, der oft so spottbillig verspottete Hoffmann – auch er war ein Sänger der Freiheit. Und die Nazis hätten auch einen wie ihn ins Exil gejagt oder totgeschlagen. Also liefere ich Ihnen von nun ab kein Wort mehr zu Hoffmanns Verteidigung, sonst fangen wir alle an, uns zu langweilen.
Wußten Sie übrigens, daß die Nazis sogar den großen Schiller posthum ins Exil trieben? Sie erwiesen ihm die höchste Ehre, die sie zu vergeben hatten: 1933 warfen „Nationale Studenten“ auch Schillers Werke in die Flammen der Bücherverbrennung. Sie schmähten ihn als „undeutsch“. Und folgerichtig wurde 1938 das Schillerdenkmal auf dem Gendarmenmarkt in Berlin entsorgt. Nein, dies war kein Mißverständnis der Nationalsozialisten, denn Schiller schrieb in einem Brief an Christian Gottfried Körner: „Es ist ein armseliges, kleinliches Ideal, für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich.“
Das aber kennzeichnet die tragische geschichtliche Konstellation des Hoffmann von Fallersleben: Wenn er mit seinen Versen für den Fortschritt kämpfte, nämlich für ein geeintes Deutschland, dann hinkte er automatisch hinter dem Zustand des avancierten Weltgeistes in Frankreich und England und sogar Russland hinterher. Die größeren Zeitgenossen, etwa der alte Goethe, der gleichaltrige Heine, waren damals schon zwei Schritte weiter. Sie fühlen sich längst als Citoyens der Menschheit à la Jean-Jacques Rousseau und nicht hauptsächlich als patriotische deutsche Gartenzwerge. Aber in diesem Punkte war der kleine Dichter Hoffmann größer als seine Kollegen Großdichter. Geheimrat Goethe war mit seinem Kopf schon europäisch globalisiert und steckte seine Nase in die ganze Gattung Mensch. Mit dem Hintern aber saß er weich und bequem auf dem feudalen Misthaufen in Weimar als geadelter Fürstenknecht seines Herzogs Karl August.
Der brave Hoffmann also tat – so gut es gelang - genau das, was Goethe gelegentlich anderen riet: immer das Nächstliegende anpacken! Man könnte klempnerisch sagen: Der Kunsthandwerker Hoffmann machte den Upperclass-Poeten die notwendige Drecksarbeit.
Dabei will ich Ihnen hier gestehen, daß ich oft neidisch bin auf diesen populären Liederdichter. Meine jüngste Tochter Mollie nämlich (sie kommt nächstes Jahr schon in die Schule) kennt mehr Lieder von diesem Hoffmann als von mir, obwohl sie tagtäglich zu Hause ihren Papa singen hört. Sie kennt jeden Ton und jedes Wort der offenbar unverwüstlichen Kinderschlager des Hoffmann von Fallersleben. Begeistert singt sie das Lied vom Sängerstreit zwischen Kuckuck und Esel. Gewiß, Hoffmann selbst war der Kuckuck , und Heinrich Heine die Nachtigall. Ich, ihr Vater, wäre in diesem Spielchen womöglich der politpoetische Tendenz-Esel.
Meine Mollie also liebt den Dichter der schönsten deutschen Kinderlieder. Mit Entzücken trällert sie das Lied „Alle Vögel sind schon da“. Und auch mitten im Sommer singt sie beseligt „Morgen kommt der Weihnachtsmann...“. Und im Herbst kräht sie: „Winter ade! Scheiden tut weh...“ . Mit dem Vortrag des Hoffmann-Hits „Summ summ summ, Bienchen summ herum ...“ beglückt sie Oma und Opa. Der Schlager „Ein Männlein steht im Walde auf einem Bein ...“ ist ihre Glanznummer, wenn Freunde zu Besuch sind.
Es sei hier unter uns ein Fußnote zu einem der Kinderlieder geliefert: Das muntere Liedchen von den Vögeln, die im Frühling alle schon wieder da sind, wurde von den Nazis ganz besonders niederträchtig mißbraucht. Mit genau diesem Lied auf den blutig geschlagenen Lippen mußten nach der Machtergreifung 1933 die verhafteten Juden durch die Straßen von Berlin marschieren, und unter dem Gejohle des Packs und unter den Kolbenschlägen der Bewacher ins KZ Dachau... „Alle Vögel sind schon da ...“
Wenn im KZ Auschwitz geflüchtete Häftlinge wieder eingegfangen worden waren, wurden diese Menschen in einer grauenhaft lustigen Operetteninszenierung von ihren Henkern zurückgebracht. Die Häftlingskapelle mußte dann Hoffmanns Lied spielen als flotten Marsch. Und die Todgeweihten mußten am Spalier der angetretenen KZ-Häftlinge vorbeimarschieren zum Prügelbock und zum Galgen. Und weil die geflüchteten Vögel wieder eingefangen waren, mußten die Gepeingten selber in dieser Zeremonie laut singen:
Alle Vögel sind schon da,
Alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n!
Frühling will nun einmarschier'n,
Kommt mit Sang und Schalle.
Und wenn dann das Reimwort „einmarschier´n“ kam, dann hatten die SS- und Gestapo- Leute und die Wachleute der Wehrmacht ihren Heidenspaß.
Nur weil der Dichter vor hundert Jahren kein besseres Reimwort gefunden hatte, mußte der Frühling marschieren und mit ihm die Gepeinigten. Aber sogar in stärkeren Gedichten besserer Poeten kann ein einziges falsch gesetztes Wort alles verderben, alles ungenießbar machen wie eine ausgelaufene Galle das berühmte Huhn im Topf der armen Leute.
Es gibt ein Kinderlied vom Brecht, der nannte es 1949 mit schlauem understatement gegenüber der Becherhymne „Kinderhymne“. Dieses Lied könnte eines wirklich schönes Tages die neue Nationalhymne der Deutschen werden. Das Lied existiert, sogar mit Musik, wir Deutschen haben es sozusagen in Reserve. Womöglich ist unser Land nur noch nicht reif dafür.
Mag sein, vielleicht erleben es die Jüngeren unter Ihnen ja noch, daß der Deutsche Bundestag in einer wahrscheinlich wütenden Kampfabstimmung Brechts Kinderhymne zur offiziellen Hymne auch für die Erwachsenen erklärt. Ich werde Ihnen das kurze Stück zum Schluß vorsingen. Und dann hätten Sie einen kleinen Vorsprung vor Ihren deutschen Mitbürgern. Ich will Ihnen aber ausgerechnet an diesem hinreißend schönen Text zeigen, daß auch das Weltgenie Brecht nur mit Wasser kochen konnte. Die Worte gehn so:
Kinderhymne
Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Daß ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land
Daß die Völker nicht erbleichen
Wie vor einer Räuberin
Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.
Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.
Und weil wir dies Land verbessern
Lieben und beschirmen wir's
Und das liebste mag's uns scheinen
So wie andern Völkern ihrs.
Ich hatte vor Jahren die Gelegenheit, den originalen Versuch Brechts zu lesen, wie er im Brechtarchiv in der Chausseestraße aufbewahrt wird. Da heißt die erste Zeile nicht etwa „Anmut ...“ sondern: Arbeit sparet nicht noch Mühe ...
Und dieses allererste Wort „Arbeit...“ hat der Meister dann im Schreibmaschinen-Skript mit der Hand durchgestrichen und verbessert mit einem Wort, das wir alle lieben und seit Schillers Essay dessen tiefere Bedeutung auch begriffen haben: Anmut... Ohne dieses Zauberwort „Anmut“ aus dem Gürtel der griechischen Schönheitsgöttin Venus wäre Brechts erste Zeile eher geeignet als Anfang eines Liedes für den stalinistischen Stachanow-Wettbewerb um den Titel „Held der Sozialistischen Arbeit“: Arbeit!! sparet nicht!! noch Mühe!! ...
Und dennoch bleibt nach dieser Verbesserung eine interessante Schwachstelle im vollendeten Gedicht. In der schlechten Erstfassung: „Arbeit sparet nicht noch Mühe ...“ bedient das Wörtchen „sparet“ bestens die beiden Hauptbegriffe: Arbeit und Mühe. Weder an Arbeit noch an Mühe sollte nach Meinung des Herrn Brecht beim Auferstehen aus den Ruinen des II. Weltkrieges gespart werden. Aber die entscheidende Verbesserung mit dem zarten und eleganten Wort „Anmut“ war zugleich eine Verschlechtbesserung. Das folgende Scharnier-Wort „sparet nicht ...“ wurde nun unsinnig und unsinnlich. Warum? Anmut hat der Mensch oder er hat sie nicht, da gäbe es also gar nichts zu sparen.
Dennoch begeistert mich diese Brechtsche Kinderhymne. Lassen Sie mich zum Schluß sagen warum: Brecht spielt da nämlich genial mit Hoffmanns geflügeltem Unwort „Deutschland über alles in der Welt“. Brecht ließ sich nach dem Sieg über Nazideutschland nicht wie viele Andere in die dazu passende Gegendummheit fallen. Er widersprach dem aggressiven Selbstmitleid vieler Deutscher nach dem Krieg. Solche all zu flotten Umlerner tönten nun: Wenn wir also nicht mehr auserlesen sein dürfen als Herrenvolk über allen Völkern - ok! - dann wollen wir in der Schande unserer Niederlage wenigstens auserlesen tief tief unter allen Völkern sein. Sie verstehen schon: Nach dem gröhlenden Größenwahn war dies der After-Chauvinismus.
Ich habe Ihnen hier mehr zu danken als Sie vielleicht denken. Die Auszeichnung hat mich irritiert und angestachelt. Und daß ich hier heute vor Ihnen stehen muß und stehen darf und auch will, das hat mich dazu gezwungen, dem deutschen Dichter Hoffmann von Fallersleben gerechter zu werden. Ihre lokalpatriotisch gewachsene Zuneigung zu diesem Menschen teile ich inzwischen, und muß mich dabei ganz und gar nicht verrenken. Also wage ich zum Schluß eine arglos fröhliche Behauptung: Der Dichter des Liedes der Deutschen würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hell begeistert sein, wenn er da oben neben Brecht auf der Wolke sitzt und diese neue Hymne der Deutschen mit der raffiniert einfachen Musik von Hanns Eisler bis hoch in den Dichter-Himmel klingen hörte. Er würde sich selbst zitieren, er würde schwärmen wie auch hoffentlich Sie hier in Höxter: „Welch ein Singen, Musiziern!“